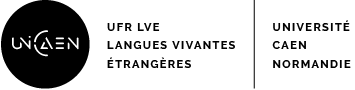Der Krieg, wie ihn der Postbote von Cetica erlebt hat
Vorwort
Als ich mich gedanklich darauf vorbereitete, meinen Onkel Gilberto zu interviewen oder besser gesagt, mit ihm einige Plauderstunden zu verbringen, hatte ich nicht die geringste Ahnung, von wie vielen Dingen er mir erzählen und wie viele andere, mehr oder weniger wichtige Ereignisse, er mir enthüllen würde. Es war in den ersten Junitagen des Jahres 1998, als er vor dem ungewohnten Mikrofon erzählen sollte und deshalb anfänglich etwas zurückhaltend war, aber allmählich wurde es ihm zur Gewohnheit und so selbstverständlich, dass er mich abends sogar anrief, wenn ich mich mal verspätete, denn er konnte es nicht abwarten, seiner Erzählkunst freien Lauf zu lassen. Allabendlich saßen wir so immer zwei Stündchen zusammen: Er redete und ich hörte ihm zu und nahm alles auf Band auf. Seine Schwester Gabriella war während unserer Plauderstunden ebenfalls zugegen und intervenierte gelegentlich, indem sie dem zustimmte, was Gilberto erzählte oder etwas hinzufügte oder auch sagte: „Nein, das nicht, es wäre besser, das nicht zu sagen“, woraufhin sie gleich zum Schweigen gebracht wurde, denn er hatte nun einmal das Bedürfnis, mir immer alles frei heraus zu erzählen, auch wenn es sich manchmal um unbequeme oder heikle Themen handelte.
Plauderstündchen hin, Plauderstündchen her, inzwischen waren sieben oder acht Monate vergangen, während derer ich viele Lebenserinnerungen und sonstige Geschichten aufzeichnen konnte. Nach dieser ersten Runde habe ich mich daran gemacht, alles Erzählte ins Reine zu schreiben und indem wir Tag für Tag das Geschriebene nochmals durchlasen, hatte Gilberto Gelegenheit, das Aufgezeichnete nochmals zu überdenken, zu kommentieren, richtig zu stellen oder auch etwas hinzuzufügen, denn neue Einzelheiten und Erinnerungen kamen ihm fortlaufend ins Gedächtnis. Und so fuhren wir in dieser Weise fort bis zum 7. August 1999, das war der letzte Tag vor seinem Ableben1 Gilberto Giannotti wurde am 17. Februar des Jahres 1916 in Strada in Casentino geboren und verstarb in seinem Heimatort am 8. August 1999. und ich erinnere mich, dass die letzten Erzählungen von Don Giovanni Bozzo handelten.
Über eine Sache bin ich mir ganz im klaren: Gilberto war jemand, der es nicht fertig brachte, Groll gegen jemanden zu hegen und die ausgedehnten Gespräche, die wir zusammen geführt haben, haben mich davon überzeugt, dass er all das Erlebte nochmals in Erinnerung bringen und darüber reden wollte, um einesteils mit mir auf den Spuren seiner Lebensreise zu wandeln, aber andernteils war es vor allem sein Wunsch, dass diese Lebenserfahrungen und die Erinnerungen an seine Familie, an Freunde, Bekannte und auch an die Menschen von damals, die ihn angefeindet hatten, dass all diese Erinnerungen nicht verloren gingen, sondern für immer in uns bewahrt blieben, in unserem Gedächtnis und in unserem Herzen.
Der hier publizierte Text ist dem Hauptteil des Buches Mi ricordo che... (Ich erinnere mich, dass...) von Gilberto Giannotti2 G. Giannotti, Mi ricordo che... Erinnerungen, Geschichten, Briefe von Gilberto Giannotti, herausgegeben von G. Ronconi, Castel San Niccolò (AR), Eigenverlag Fruska – Gianni Ronconi, 2001 (Druck in limitierter Auflage, die bereits vergriffen ist). entnommen, aus dem Abschnitt, der hauptsächlich die Zeit des Zweiten Weltkriegs berücksichtigt. Die Lebenserinnerungen, die mein Onkel in der Sprache des im Casentino gesprochenen Dialekts in Worte kleidete und die dann so wortgetreu in das obenbenannte Buch übertragen wurden, sind von mir in dieser neuen Ausgabe italienisiert worden, um in dieser Fassung von allen leichter lesbar zu sein und besser ins Französische und Deutsche übersetzt werden zu können.
Der Krieg bricht aus 3 Als ich mich das erste Mal zum Militärdienst meldete, hatte Gilberto sich für zehn Monate zur Infanterie nach Perugia verpflichtet, von Anfang März bis Ende Dezember 1938, und zwar als Schreibkraft. Im Mai 1940 wurde er als Telefonist und Wachposten in Arezzo eingesetzt, zuerst in der Kaserne Piave und anschließend beim Bezirkskommando, wo er bis März 1942 Dienst tat. Dann wurde er das zweite Mal beurlaubt. Im Juni 1943 kam er nochmal zum Einsatz, aber nach dem 8. September kehrte er zurück nach Hause.
Am 10. Juni 1940 bricht der Krieg aus. An dieses Datum, einem Montag, erinnere ich mich sehr wohl, denn montags war in Strada immer Markttag. Am Samstag davor hatte ich einen Urlaubsschein erworben und war auf dem Wege nach Arezzo. Es war schon fast Mittag und ich wartete auf dem Halteplatz auf den Kleinbus von Francioni, um nach Porrena in die Kaserne zurückzukehren, als Mussolini seine Ansprache begann und den Italienern verkündete, dass Italien entschieden hat, in den Krieg einzutreten. Ich stand nun da und schickte mich an, in den Kleinbus von Francioni4 Francioni war der Inhaber des Transportunternehmens, das die Fahrgäste von Strada in Casentino nach Porrena beförderte, von wo aus Gilberto dann den Zug nahm, der ihn nach Arezzo brachte. einzusteigen. Der Bus war von einer flachen Bauart mit tief gelegenem Schwerpunkt und einer Stufe für den Einstieg. Ich hatte bereits einen Fuß auf dem Trittbrett, als genau in dem Moment die Stimme Mussolinis aus dem Radio ertönte und ich die folgenden Worte hörte: „Italienisches Volk, greift zu den Waffen.“ Da drüben, vor der Gemeinde, hatten sich natürlich alle Faschisten von Strada mit ihren Anführern versammelt, um aus dem Radio die Ansprache des Duce zu verfolgen, all die aufgeplusterten Fanatiker, die sich für den Kriegseintritt groß machten. Immer noch mit einem Fuß auf dem Trittbrett weilend, rief ich ihnen zu: „Also, worauf wartet ihr, seht her, ich gehe, ich bin bereit, dem Aufruf Mussolinis zu folgen, und ihr wollt hier verharren? Er hat euch gerufen und ihr folgt seinem Aufruf nicht?“ und darauf stieg ich in den Bus. Ganz nahebei standen viele Faschisten, unter ihnen auch ein Ladenbesitzer aus Strada, einer der zu gegebener Zeit und wie es ihm gerade passt, sein Mäntelchen nach dem Wind hängt, dessen Sohn sich in den letzten Kriegswirren unter die Partisanen mischte und es ist wohl besser, ich erzähle hier nicht weiter, dieser Krämer rief mir zu: „Hört euch den mal an, immer der Gleiche! Mit dem ist einfach nichts anzufangen.“ Die hätten mich glattweg zusammengeschlagen, aber Francioni ließ den Motor an und fuhr los.
Wie ich später erfuhr, befand sich in der Menschenmenge auch Cameo di Casanini, ein tapferer Gleichgesinnter, der, als die Radioansprache von Mussolini beendet war, inmitten der vor Freude taumelnden Masse ganz unerschrocken und laut ausrief: „Nieder mit dem Krieg!“ Diese Faschisten, fanatisch und gewalttätig wie sie sich meistens gebärdeten, hätten den Cameo am liebsten verprügelt, aber waren ob seiner Unerschrockenheit so verdutzt, dass es dazu nicht kam und nicht zuletzt auch wegen der großen Menschenmenge, die sich zu der Zeit dort versammelt hatte, übten sie Zurückhaltung. Ich erfuhr dann, dass er noch am gleichen Abend von zwei oder drei Leuten aufgesucht und ihm gedroht wurde, und dass man von ihm verlangte, seine Äußerungen zurückzunehmen, aber vergeblich, er blieb standhaft und bei seinen Ideen.
Als Mussolini in den Krieg eintrat, äußerte er folgende Worte: „Um mit am Verhandlungstisch zu sitzen, um zusammen mit den Siegern an einem Tisch sitzen zu können und um der Teilung Europas willen, brauche ich einen Toten.“ Aber es gab nicht nur einen Toten, auch nicht nur drei oder vier. In unserer Gemeinde allein gab es erste Tote wegen Kriegshandlungen. Das erste Opfer war ein Bersagliere aus Valgianni, der 1935 im Afrikakrieg gefallen war. Und das erste Opfer im Albanienkrieg im April 1939 war Giuseppe Ghedini, der Apotheker hier aus Strada, den man eingezogen hatte. Obwohl die Kriegserklärung noch nicht offiziell war, startete er von Bari aus mit dem Flugzeug zu einer militärischen Mission und stürzte ab, vielleicht wegen einer Fehlsteuerung. Die ersten, die davon in Strada erfuhren, waren ich und Corradi Landi, denn als abends die Nachricht von seinem Tode eintraf, befanden wir uns im Postamt, weil wir dorthin beordert waren, um den Fernschreiber zu überwachen, damit die neuesten Nachrichten aus den Kriegsgebieten sofort aus erster Hand empfangen werden konnten. Als die sterblichen Überreste dann nach Strada überführt wurden, gab es eine feierliche Beerdigung an der alle Autoritäten teilnahmen und wenn ich mich recht erinnere, war sogar Italo Balbo auf der Beerdigung.
Eine weitere bedeutende Persönlichkeit, die während der Zeit des Faschismus nach Strada kam, war Storace, der Sekretär der Partei der Nationalen Faschisten. Übrigens gibt es darüber eine amüsante Episode zu erzählen. Als Storace in Arezzo eintraf, bereiteten die Faschisten ihm einen triumphalen Empfang und hoben ihn auf Händen in die Höhe. Das Komische an der ganzen Sache war, dass er, anstatt sich zu freuen, die Leute angrölte: „Lasst mich runter, lasst mich runter, ich will das nicht!“ „Nein, nein“, brüllten sie alle und trugen ihn hoch und höher. „Nicht doch, lasst mich runter, hört auf mit dem Unsinn! Lasst mich jetzt runter, hab ich euch gesagt. Ihr habt mir die Eier gequetscht.“ Sodann ließen sie ihn runter und er: „Ich hatte euch doch gesagt, mich runterzulassen. Ihr habt mich zum Narren gehalten!“ „Nein, nein, das stimmt nicht“, riefen alle. „Doch, doch, ihr habt mich zum Narren gehalten“. Dies hat sich tatsächlich in Arezzo zugetragen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ob er in Strada einen ähnlichen Empfang über sich ergehen lassen musste, aber ich glaube nicht.
Ein Brief con Federica
Während meiner ganzen Zeit die ich in Arezzo verbracht habe, erhielt ich regelmäßig Post von zuhause: von Vati, Annina, Aurora, Giannetto, sogar von Federica5 Annina war die Tante von Gilberto und wohnte bei ihm in seinem Hause. Giannetto, Aurora und Federica waren die Geschwister von Gilberto. Der Onkel Gigi wohnte ebenfalls bei ihnen. Gilberto hatte außerdem noch eine Schwester, Leda, und natürlich seine Mama, Lisa. die noch in der Grundschule war, und das obwohl ich an fast allen Samstagen zuhause sein konnte, entweder mit oder auch ohne Urlaubsschein:
11. Oktober 1940, ANNO XVIII, ich schick Dir dieses kleine Büchlein, zusammen mit meinen lieben und herzlichen Gedanken. Lies es aufmerksam durch, es ist eigens für Euch geschrieben, die Ihr für unser Vaterland kämpft. Du wirst es doch bestimmt lesen? Versprochen? Mit meinem Herzen bin ich immer bei Dir und wünsche mir, Dich bald wieder umarmen zu können. Welche Freude, wenn Du zurückkämst nach einem errungenen großen Sieg. Ich bete immer, dass dies geschehen möge und dass die Madonna Dich behüten und beschützen möge. Und Du, vergiss nicht, Dich unserem lieben Herrgott anzuempfehlen, und sei achtsam, ihn nicht zu beleidigen durch sündhaftes Verhalten. Viele liebe Küsschen sendet Dir Dein Schwesterchen.
Dieses Briefchen hat Federica geschrieben, als sie in der 5. Grundschulklasse war. An diesem Brief ist klar ersichtlich, was den Kindern in der Schule erzählt wurde und was ihnen eingeflößt wurde zu schreiben. Besonders in den Grundschulen war es an der Tagesordnung, dass die Lehrerinnen Propaganda für den Faschismus machten und diejenige, die nicht mitmachen, aber weiter unterrichten wollte, der blieb nichts anderes übrig, als sich zu fügen. Die Schulkinder waren einer ständigen Gehirnwäsche ausgesetzt, um sie mit dem Gedankengut des Faschismus aufwachsen zu lassen. Als dann der Faschismus zusammenbrach, wurden diese Lehrerinnen angeprangert und einigen wurde sogar für eine gewisse Zeit Unterrichtsverbot erteilt. Auch die, die sich mit besonderem Eifer hervorgetan hatten, wurden jetzt gebrandmarkt, wie zum Beispiel Mitglieder der faschistischen Sturmabteilung oder andere, die mit Übereifer bei der Sache waren. Ja, so war das nun mal, wir mussten so allerhand über uns ergehen lassen, aber alles konnte man sich wiederum auch nicht bieten lassen, als wäre nichts geschehen. Mit der Zeit und so ganz allmählich wandelten sich jedoch die Dinge und die Lebensverhältnisse normalisierten sich und wurden auf ihr rechtes Maß zurückgeführt, nicht zuletzt auch dank der Amnestie. Und so wurden auch die Lehrerinnen aus Strada wieder rehabilitiert und konnten ihre rechtmäßige Lehrtätigkeit wieder aufnehmen. Und weißt du wer diesen Amnestieerlass erwirkte? Togliatti!
Dass dieser Brief von der Lehrerin suggeriert und kontrolliert worden war, das kannst du auch daran erkennen, wie das Datum geschrieben wurde: XVIII bedeutete die Zeit der Faschismusherrschaft. So hatte ich das Datum noch nie geschrieben und ich bin mir sicher, dass bei uns zu Hause keiner das Datum jemals so geschrieben hätte. Das Büchlein war ebenfalls in der Schule entstanden und für die Soldaten bestimmt, um den Faschismus und den Krieg zu verherrlichen. Und wenn du mal überlegst, wie konnte ich, der ich in Arezzo war, mich einsetzen im Kampfe für den Sieg?
Die Untersuchung im Sangallo und der Anfang des Schleichhandels
Ich hatte schon seit einiger Zeit versucht, den Militärdienst zu quittieren, und im Februar 1942 war es dann endlich soweit: Ich hatte es erreicht, meinen Entlassungsschein zu bekommen, der mir aufgrund meines Gesundheitszustandes zuerkannt wurde. Ich hatte mich nämlich einer Zahnuntersuchung unterziehen müssen, denn schon seit langem waren alle meine Zähne wegen einer Alveolarpyorrhöe von Karies befallen. Die Untersuchung wurde im Sangallo-Hospital in Florenz durchgeführt. Als ich damit durch war, blieb ich noch den ganzen Tag in Florenz, und da es bitterkalt war, ging ich zu meinem Bekannten Freschi6 Der Freschi war Lastwagenfahrer, der tagtäglich Waren vom Casentino nach Florenz und zurück transportierte., der einen Laden hatte, um mich aufzuwärmen, und dort traf ich auch den Chiarini. Abends nahm ich dann den Zug nach Arezzo. Am nächsten Tag wurde mir der Entlassungsschein ausgestellt und danach fuhr ich nach Hause.
Vom Tag der Entlassung bis zu dem Zeitpunkt, als ich wieder zum Dienst eingezogen wurde, hatte man sich, so gut es eben ging, durchschlagen müssen; den anderen Familien war es ähnlich ergangen. Esswaren und sonstige Gebrauchsartikel waren kaum noch zu haben, und so entstand zu der Zeit auch der Schwarzhandel, und folgerichtig auch das Verbot, Waren ohne erteilte Erlaubnis von einer Provinz in die andere zu schaffen. Von diesem Verbot waren fast alle Warengattungen betroffen. Erlaubnisscheine für die Beförderung von Waren wurden in Arezzo von der Sepral genehmigt, ein Büro in der Präfektur. Fast alle Waren unterlagen der Genehmigungspflicht, ausgenommen Obst und Gemüse, glaube ich mich zu erinnern. Von den Behörden beauftragte Personen waren dafür zuständig zu kontrollieren, dass unerlaubte Waren nicht etwa schwarz und auf Schleichwegen transportiert wurden. Im Einzugsbereich Strada waren Rino und Gegio Ferretti7 Beide hießen Ferretti, waren aber nicht miteinander verwandt. damit beauftragt zu kontrollieren, zwei Unglücksraben, die, auch wenn sie auf Seiten der Faschisten standen, sicherlich keine Bösewichte waren. Und mit Gegio waren wir sogar schon länger befreundet: Und weißt du, wenn ich nur daran denke, welche Pilzmengen mein Väterchen von ihm gekauft hat. Die beiden „Bösewichte“ überwachten insbesondere den Lastwagen von Freschi, der ständig zwischen dem Casentino und Florenz hin und her pendelte, denn für diejenigen, die viel unterwegs waren, war es natürlich leichter, mal heimlich was von einem Ort zum anderen zu schaffen. Wenn ich mal zusammen mit Freschi von Florenz zurückkehrte, und nachdem wir die bestellten Waren an die verschiedenen Kunden ausgeliefert hatten, zum Beispiel Äpfel und Pilze, versuchte ich immer irgend etwas mitzubringen: Wer weiß, was da alles drin war, womit dann schwarz gehandelt wurde. Der Schwarzhandel betraf alle nur vorstellbaren Waren die rationiert und deshalb schwer zu kriegen waren, wie zum Beispiel Leder, Öl, Kaffee, Wein, Petroleum und vieles andere. Wir hatten zu jener Zeit einen Laden am Piazzone und wenn wir aus Florenz zurückkamen, gingen wir erst einmal zur Giovannina8 Der Piazzone ist ein Platz und die Giovannina eine Bar in Strada in Casentino. und danach wurde der Laster in Eile entladen, damit der Freschi seine Weiterfahrt nach Bibbiena fortsetzen konnte.
Einmal geschah es, dass wir auf unserer Rückfahrt, bevor wir Strada erreichten, erfuhren, dass Rino und Gegio vor der Bar Giovannina auf uns warteten. Ich hatte kaum was dabei, nur ’ne Kleinigkeit. Wir wollten den beiden natürlich nicht geradewegs in die Arme laufen. Also fuhren wir zuerst zum Piazzone, entluden alles in Windeseile, dann drehte Freschi seine übliche Runde und hielt vor der Bar, um anschließend nach Bibbiena weiterzufahren. Als Rino und Gegio ihn sahen, folgten sie ihm auf den Fersen und glaubten wohl, er würde wie üblich jetzt abladen. Vorher hatten sie ihn nicht gesehen, denn zu jener Zeit musste man mit Abblendlicht und zusätzlicher Verdunkelung der Scheinwerfer fahren. Ich wartete, dass der Lastwagen wieder die Straße runter kam und dann, in aller Ruhe und als ob nichts geschehen sei, machte ich mich auf den Nachhauseweg. Sobald die beiden mich sahen, begriffen sie augenblicklich, dass wir ihnen ein Schnippchen geschlagen hatten: „Sieh mal, wer da geht. Und der Lastwagen? Die haben uns mal wieder ganz schön überlistet“, sagte einer der beiden, aber sie machten keinerlei Anstalten mich zu befragen und schwiegen. Ich ließ ebenfalls nichts verlauten und ging nach Hause. Gegio und Rino fahndeten nach allem, auch die Sita9 Die Sita war die offizielle Buslinie und beförderte Fahrgäste von und nach Florenz. wurde regelmäßig durchsucht. Und wenn sie manchmal in einem Korb oder in einer Tasche etwas fanden, das nicht erlaubt war, dann konntest du sicher sein, dass das Gefundene niemandem gehörte und der Besitzer nie ausfindig gemacht werden konnte.
Der 25. Juli 1943
In einer Villa oberhalb des Dorfes wohnte der Ingenieur Spreafico. Schon seit einiger Zeit versorgte ich ihn mit allerhand Dingen aus meinem Laden und brachte ihm die Sachen mit dem Fahrrad oder mit einem Handkarren, und es war recht mühselig, den Karren den steilen Weg hinauf zu seinem Haus zu schieben. In dieser Villa arbeiteten drei oder vier Frauen als Dienstmädchen und dieser Ingenieur musste eine hohe Stellung im Waffenhandel bekleidet haben, aber wie er mir zu verstehen gab, war er gegen Mussolini.
Ich war also wieder einmal oben in seiner Villa, es war der 25. Juli 1943, ein Sonntag, als er mir sagte: „Haben Sie das Radio heute Morgen gehört?“ Ich erwiderte: „Nein, ich war schon früh auf den Beinen und war bis jetzt im Laden. Warum, gibt’s ’ne Neuigkeit?“ Ich merkte, dass er unschlüssig war und sich zurückhielt, dann blickte er in die Runde und als keiner mehr da war und die Luft rein war, sagte er mir: „Es gibt was Neues, heute Abend um elf Uhr wird verkündet, dass Mussolini gestürzt worden ist.“ Der wusste das also schon. Ein Zeichen, dass er über gute Kontakte verfügte, denn wie hätte er das sonst wissen können? Wieder zurück in Strada, verbrachte ich den Vormittag, ich weiß nicht mehr mit wem, und traf dann Bagnoli und konnte mich mit der Neuigkeit nicht mehr zurückhalten und sagte ihm insgeheim: „Ich hab ’ne tolle Nachricht. Mussolini ist gestürzt worden und heute Abend um elf Uhr wird es bekannt gegeben.“ Und er: „Wo hast du die Neuigkeit denn schon wieder aufgegabelt. Wenn keiner das weiß, wie willst du das denn wissen?“ „Mir hat das jemand anvertraut, und wenn ich dir das weitergebe, bedeutet das, dass ich es von jemandem erfahren habe.“ Man konnte natürlich keinen Lärm schlagen und mit der Neuigkeit herausplatzen, aber am Nachmittag, nachdem ich engere Freunde eingeweiht hatte, gingen wir zusammen, ich, Cicalino und Bruno di Marco, zum Pizzico bei Lisa, um dort unter uns zu feiern. Als wir dann auf unserem Nachhauseweg waren, waren wir so froh gestimmt, dass wir die ganze Zeit sangen, ein Lied, an das ich mich nicht mehr genau erinnern kann:
Ihr Schurken, steiget nun herunter von euren Thronen,
die uns mahnenihr seid auf falschen Wegen und so leget nieder eure Fahnen
der anbrechende Tag kündigt von neuen Sonnenbahnen...
und dann ging das Lied noch weiter, ungefähr so:
Die Herren dieser Welt, wir warten noch auf ihre Taten
eine verheißungsvolle Zukunft, sagen sie, sind ihre Saaten
auf die wir immer noch sehnsüchtig, doch vergeblich, warten...
Am Abend, wie immer allsonntäglich, war Kino und als die Menschen herausströmten, so gegen elf, standen da alle mit offenem Mund und hörten die Radionachricht, dass Mussolini gestürzt worden ist. Kurz danach hatte man ihn auch verhaftet, an das Datum kann ich mich nicht genau erinnern, und in die Abruzzen nach Campo Imperatore gebracht und dort gefangen gehalten. In einer Überraschungsaktion hatten ihn die Deutschen dort mit einem Kommando per Flugzeug aus der Luft aus dem Kerker befreien können. Nun war er wieder auf freiem Fuß und verkündete anschließend die Repubblica di Salò (Italienische Sozialrepublik), die noch mehr Schaden verursachte als bereits angerichtet. Als er gestürzt wurde, hatten viele Faschisten gefürchtet, dass es nun mit dem Faschismus ein Ende hätte, und wir hatten ebenfalls vermutet, dass nun eine Wende eintreten und ein Umschwung stattfinden würde. Aber noch mehr Angst hatten diejenigen, die nicht durch und durch Faschisten waren, die eher halbherzig bei der Sache waren, obwohl sie sich zum Faschismus bekannt hatten, die keine Eingefleischten und Übereifrigen waren und andere nie belästigt hätten. Ich erinnere mich noch, dass mich einer von ihnen gebeten hatte, ihn nach Hause, nach Prato, zu begleiten weil er fürchtete, man könnte ihm beim Alberotorto auflauern. Ich bin gerne mit ihm gegangen, weil es eine ehrliche und rechtschaffene Person war. Ich und die Meinen, und alle die, die so dachten wie wir, wir wähnten uns schon im siebenten Himmel und dachten bei uns und hofften inniglich, dass mit dem Sturz Mussolinis nun auch der Faschismus tatsächlich ein Ende hätte. Das war leider nur Wunschdenken, denn das Schlimmste stand uns noch bevor.
Der 8. September 1943
Als ich das zweite Mal zum Militärdienst einberufen wurde, das war 1943 um den Juli herum, und wieder beim Bezirkskommando vorstellig wurde, schickte man mich in das gleiche Büro, wo ich schon zuvor längere Zeit meinen Dienst getan hatte. Aber diesmal blieb ich nur kurze Zeit, nur ein paar Monate, bis zum 10. September, d. h. zwei Tage zuvor hatte die allgemeine Massenflucht um sich gegriffen, auch der König war geflohen. Am 8. September 1943 dann, alle dienstfrei und ab nach Hause. Denn an dem Tag, der Tag des erklärten Waffenstillstands, hatten sich der König und Badoglio, der an Mussolinis Stelle als Regierungschef ernannt wurde, in weiser Voraussicht in Sicherheit gebracht und sich nach Brindisi abgesetzt, wo sie unter dem Schutz der Alliierten standen. Mit diesem unrühmlichen Akt hatten sie ihr eigenes Land verraten und seinem Schicksal überlassen. Die Armee war ohne Befehlshaber, gänzlich führungslos, geriet ins Wanken und brach schließlich zusammen. Fast alle flüchteten, denn das Vordringlichste war, sich selbst in Sicherheit zu wissen vor den Faschisten und den Deutschen, die noch bis zum Tag vorher Italiens Verbündete waren und am Tag danach von Badoglio zum Feinde erklärt wurden.
In dieser führungslosen Zeit, als alle davonliefen, blieb ich weiterhin auf meinem Posten, weil mein Vorgesetzter, Oberst Chiaja, noch die nächsten Tage abwarten wollte, um zu sehen, wie sich die Situation weiter entwickeln würde. Aber am 10. September fuhren die Deutschen beim Bezirkskommando mit einem Panzerspähwagen vor, stellten das Fahrzeug quer zum Haupteingang, damit keiner entwischen konnte und kamen herein. Ich konnte mit noch anderen Kollegen rechtzeitig aus der Hintertür des Kommandogebäudes flüchten, aber Oberst Chiaja wurde festgenommen und abgeführt. Als ich von Deutschland zurückkam, erfuhr ich, dass er ebenfalls deportiert worden war, zuerst nach Deutschland und dann nach Polen, von wo er nach Kriegsende zurückkehrte. Eines Tages rief mich der Polizeimeister der Carabinieri von Strada zu sich, weil Oberst Chiaja sich nach mir erkundigt hatte. Er dachte nämlich, dass auch ich am gleichen Tage wie er festgenommen wurde, am 8. September, in Gefangenschaft geraten und deportiert worden war. Ich fuhr also nach Arezzo, um ihn zu treffen, denn auch ich wollte wissen, wie es ihm ergangen war, und als wir uns trafen, waren wir zutiefst gerührt.
Mir war also die Flucht aus dem Kommandogebäude gelungen, und als erstes ging ich sofort in eine Enel-Telefonzentrale, von der ich wusste, dass dort Alfredo Aloigi seinen Dienst tat. Von dort rief ich Landino Landi an, der sich bei Severo Mugnaini in Arezzo aufhielt und bat ihn, mir einige Anziehsachen (Zivilkleidung) zu bringen, denn ich wollte nicht riskieren, den Deutschen in die Hände zu fallen. Anderes als einen Anzug von Severo, auch Jacke und Strümpfe, konnte er nicht finden. Ich war allerdings klein und schmal und Severo groß und breit, und in diesen Anzug hätte ich zehnmal hineingepasst und wie ein Clown ausgesehen, also behielt ich meine Militärkleidung an. Mit noch anderen machten wir uns also auf in den Casentino, mit Vito und Zavani aus La Spezia, mit denen wir zusammen beim Bezirkskommando unseren Dienst taten. Die erste Wegstrecke gingen wir zu Fuß, entlang der Bahngeleise bis nach Giovi, und dort stiegen wir in den Zug, um zurück in den Casentino zu fahren.
Die OT (Organisation Todt)
Nachdem Mussolini von den Deutschen beim Campo Imperatore befreit worden war, verlegte er sein Hauptquartier unter dem Schutz der Deutschen nach Oberitalien und verkündete kurz darauf die „Italienische Sozialrepublik“. Aufgrund dessen verkündeten die Faschisten eine Einberufung zum Militärdienst, die besagte, dass alle Jahrgänge von 1898 bis 1926 sich bei der Faschistischen Miliz10 Die Miliz war eine von den Faschisten gegründete geheime Staatspolizei, die in allen Gemeinden mit einem Sitz vertreten war. Wer dieser Miliz angehörte, hatte die Aufgabe, die Einwohnerschaft, insbesondere die Antifaschisten, zu kontrollieren. zu melden hätten, um eingezogen zu werden. Aber da viele diesen Aufruf boykottierten, indem sie sich einfach nicht meldeten, wurden sie von der Miliz aufgesucht und zwangsweise eingezogen. Welchen Ausweg suchten nun viele, um der Zwangseinberufung zu entgehen? Sie meldeten sich bei der Todt in Vetrignesi, um dort als Arbeiter eingestellt zu werden. Die OT (Organisation Todt) war eine von den Deutschen gegründete Arbeiterorganisation, die mit dem Auf- und Ausbau der Gotischen Linie beauftragt worden war. Im einzelnen wurden von der Todt folgende Arbeiten ausgeführt: Notparkplätze, Ausweichstellen, Laufgräben, Befestigungsanlagen, Panzerabwehrgräben und sonstige Abwehrmaßnahmen, um die Amerikaner zu bekämpfen und deren Vormarsch über die Gotische Linie hinaus abzublocken. Die Deutschen waren nämlich überzeugt, dass der Vorstoß der Alliierten von Süden her, Richtung Gotische Linie, geplant war. Um die Leute zu motivieren, bei der Todt zu arbeiten, wurden sie natürlich bezahlt, aber den meisten ging es hauptsächlich darum, der Zwangseinberufung zum Militärdienst zu entgehen. Es waren sehr viele, die sich bei der Todt gemeldet hatten, um dort oben ihren Ersatzdienst unter der neu ernannten Salò-Republik abzuleisten. Bei der Todt erfuhr man dann auch, was die Deutschen in Vallucciole11 In Vallucciole, Teil der nahegelegenen Gemeinde Stia, wurde am 13. April 1944 von deutschen Wehrmachts- und italienischen Faschisteneinheiten ein Blutbad angerichtet, bei dem 108 Zivilisten erbarmungslos getötet wurden, darunter auch Frauen, ältere Leute und Kinder, auch wenige Monate alte. angerichtet hatten, aber nicht nur die Deutschen, denn ganz bestimmt war auch die Miliz der Faschisten als Mittäter und –schuldige dabei. Nach diesen zwei oder drei Monaten Dienst bei der Todt, wollten wir nach Strada zurück. Einerseits fürchteten wir, am Ende doch noch verschleppt zu werden, andererseits hatten uns die Ereignisse in Vallucciole Angst eingejagt.
Nachdem wir wieder zurück in Strada waren, ich glaube es war an einem Montag, traf ich eine Frau aus Bibbiena, die später von den Partisanen umgebracht wurde, die mir sagte, dass diejenigen, die für ihre Arbeit bei der Todt bezahlt werden wollten, sich in der Gemeinde bei ihr melden sollten. Das war allerdings nur ein Vorwand, um erneut unser habhaft zu werden und uns wegzuholen. Aber soviel ich weiß, haben sich alle aus dem Staub gemacht, und keiner hat sich mehr bei der Todt blicken lassen oder bei der Gemeinde seine Bezahlung eingefordert.
Don Giovanni Bozzo
Die Deutschen waren hier fest stationiert und blieben auch eine ganze Weile. In dieser Zeit waren gewalttätige Übergriffe an der Tagesordnung, hauptsächlich gegen die Partisanen, aber folglich auch gegen die Zivilbevölkerung als Vergeltungsmaßnahmen. Es war wirklich eine schlimme Zeit, man war immer in Gefahr. Es verging kaum ein Tag, an dem nicht jemand abgeführt wurde oder Frauen, die fast alle allein zurückgeblieben waren, belästigt wurden. In dieser schwierigen Zeit gab es auch einen Lichtblick, denn gottseidank gab es in der Gruppe der Salesianer12 Die Salesianer, eine religiöse Gemeinschaft die von San Giovanni Bozzo gegründet wurde, bewohnten in Strada ein großes Gebäude, daß von allen Dorfbewohnern als Internat bezeichnet wurde, denn zusammen mit den Priestern wohnten dort sehr viele Jungen im Internat. Dieses Internat wurde ebenfalls von fast allen Dorfbewohnern besucht, die sich dort auf den Gebieten Religion, Schule und schöpferische Erholung betätigen konnten. auch einen Priester, Don Giovanni Bozzo, der, wenn Not am Mann war, immer bereit war, der Bevölkerung zu helfen, denn andernfalls hätte es auch noch schlimmer kommen können und mit noch mehr Toten. Dieser Priester konnte deutsch, der einzige in unserem Raum, der deutsch sprach, und er hatte sich bei den deutschen Kommandeuren fortwährend dafür eingesetzt, dass die Zivilbevölkerung von den Kriegsauswirkungen weitgehend verschont wurde, und so konnte er der Bevölkerung auf diese Weise tatsächlich sehr behilflich sein. Erleichtert wurde ihm seine Aufgabe natürlich dadurch, dass er deutsch konnte, aber er war auch ein sehr fähiger Verhandlungspartner, der genau wusste, was und wie er etwas zu sagen hatte.
Immer wenn er wegen einer Notlage gebraucht wurde, war er sofort zur Stelle und konnte durch seine geschickte Verhandlungstaktik etliche Vergeltungsmaßnahmen verhindern. Als die Partisanen bei der Riobrücke einen Deutschen getötet hatten, war er augenblicklich da und konnte erreichen, dass eine große Anzahl Personen, jüngere wie ältere, die gefangen gehalten wurden und wahrscheinlich auf kein gutes Ende hoffen konnten und womöglich den Tod durch Erschießung als Vergeltung hätten erleiden müssen, wieder freigelassen wurden. Mit seiner ganzen Energie hatte er sich immer selbstlos für alle Menschen, die in Not geraten waren, eingesetzt und getan was er nur tun konnte und folglich auch sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, denn er konnte natürlich nicht wissen, wie die Deutschen auf seine fortwährenden Bitten und Gnadengesuche, die Bevölkerung zu verschonen, reagieren würden. Was sich dann in Cetica zugetragen hatte, dass hatte auch er nicht verhindern können.
Renato del Codino erinnert sich noch ganz genau, wie seine Rettung zustande kam, er hatte mir das mehrmals erzählt. Er war damals achtzehn oder neunzehn Jahre alt und war, wenn ich mich recht erinnere, an einer Brustfellentzündung erkrankt. Eines Tages kamen die Deutschen und drangen in sein Haus ein. Er und seine Mutter Maria waren allein zuhause. Weil er verdächtigt wurde, ein Widerstandskämpfer zu sein, wollten sie ihn mitnehmen und es wäre seinerseits völlig unnütz gewesen, Widerstand zu leisten. Sie waren schon in seinem Zimmer und hatten ihn aufgefordert aufzustehen und mitzukommen, als sie einen Zettel auf seinem Nachtschränkchen liegen sahen, auf dem in deutsch was geschrieben stand. Kaum hatten sie zu Ende gelesen, ließen sie ihn sofort los und verließen fluchtartig das Haus. So, und nun rate mal, was auf dem Zettel geschrieben stand? Da stand geschrieben, dass Renato von einer ansteckenden Krankheit befallen war und dass er mit keinem Menschen in Berührung kommen dürfe. Und wer hatte das Zettelchen geschrieben? Don Bosco! Er hatte sich das alles ausgedacht für den Fall, dass die Deutschen Renato aus seinem Haus geholt hätten. Eine wirklich geschickte Kriegslist mit gutem Ende. Und er hatte weder ihm noch seiner Mutter etwas davon gesagt: er hatte alles allein ausgedacht, geplant und durchgeführt. Frag den Renato mal und du wirst sehen, dass sich alles so zugetragen hat, wie ich es dir jetzt erzählt habe. Dieser Don Bosco, was das doch für ein Mensch war!
Er war voller Tatendrang, immer bereit, überall zu helfen, wo Menschen in Gefahr waren, sein wehendes Priestergewand immer in Bewegung, und zweifelsohne haben viele Menschen ihm ihr Leben zu verdanken. Schon aus diesem alleinigen Grund habe ich nie verstanden, weshalb er nach Kriegsende sozusagen in Vergessenheit geraten war und ihn niemand gebührend in Erinnerung behalten hatte, so wie er es eigentlich verdient gehabt hätte, und wie es rechtens gewesen wäre.
Giuseppe Farina
Während ich in der Todt arbeitete, hatten sich die Faschisten kaum noch nach Cetica und in die umliegenden Berge gewagt, weil die Partisanen dort oben allgegenwärtig waren; und doch wurde Farina ein Opfer der Partisanen, die ihn überlisteten, gefangen nahmen, abführten und erschießen ließen. Giuseppe Farina war Bürgermeister von Strada und, ich glaube, gebürtig aus dem Mugello. Bevor er nach Strada kam, hatte er den Dienstgrad eines Feldwebels, aber zu der Zeit, als dies alles geschah, war er, soviel ich weiß, bereits pensioniert und mittlerweile zum Oberleutnant ernannt worden. Die Partisanen, oder deren Handlanger, hatten ihm seine Uniform, den dazugehörigen Säbel, und, soviel ich weiß, auch die Aussteuer seiner Tochter entwendet. Sie hatten ihm dann sagen lassen, dass wenn er seine Sachen zurückhaben wollte, er sie sich bei der Brücke von Pagliericcio abholen könnte. Und dieser Dummkopf, gutgläubig wie er war, ging tatsächlich dort hin. Als er sich auf den Weg machte nach Pagliericcio, traf er kurz vor Rifiglio Onkel Gigi, der gerade von Valgianni zurückkam, wo er die Post ausgetragen hatte.
Farina grüßte ihn mit den Worten: „Hallo Gigi, kommen Sie doch mit mir, gehen wir ein Stück Weges zusammen. Ich treffe mich mit den Partisanen, die bei der Brücke in Pagliericcio auf mich warten.“ Daraufhin Gigi: „Aber was in aller Welt wollen Sie denn da ausrichten?“ Und Farina erwiderte: „Die haben mir meine Uniform und die Aussteuer meiner Tochter weggenommen und wollen mir jetzt alles zurückgeben.“ „Hören Sie gut zu, Farina, Sie drehen jetzt um und kommen zurück mit mir, machen Sie keinen Schritt weiter in Richtung Brücke. Hören Sie bitte auf mich, gehen Sie nicht zur Verabredung, kehren Sie um nach Hause, das ist besser für Sie. Begeben Sie sich nicht unnütz in Gefahr!“, beschwörte ihn Gigi. Aber Farina blieb uneinsichtig. „Ich muss mich an die Verabredung halten, sie sagten, sie würden mir alles zurückgeben, das haben sie mir versprochen.“ Nun, das war’s. Jeder Versuch, ihn umzustimmen, scheiterte und Farina setzte seinen Weg allein beharrlich fort und ging zur Brücke. Dort angekommen, wurde er Opfer eines Hinterhalts. Die Partisanen ergriffen ihn, schleppten ihn fort, und im Tannenwald von Cetica, nahe der Straße nach Badia, wurde er erschossen.
Es war der 28. Juni 1944, an das Datum kann ich mich noch gut erinnern, denn am Tag danach geschah das Massaker von Cetica. Und an diesem gleichen Tag wollten die Partisanen auch mein Väterchen mitnehmen. Wie gewohnt, war er nach Cetica gefahren, um Briefe auszutragen, und als die Partisanen mit Farina in Cetica ankamen, um in Richtung Badia weiterzufahren, kamen sie dort vorbei, wo sich in dem Moment mein Väterchen befand. Als er sie mit Farina zu sich heraufkommen sah, war ihm sofort klar geworden, dass sie Farina festgenommen hatten, um ihn zu erschießen. Er versuchte sofort die Partisanen zu überreden, damit sie ihn freiließen: „Hört zu, Jungs, was habt ihr denn mit ihm vor? Wieso habt ihr ihn festgenommen? Lasst ihn doch gehen, er hat bestimmt nichts Unrechtes getan.“ „Sei still und misch dich nicht ein“, bedeuteten sie ihm mit drohender Geste. Er aber blieb bei seiner Meinung und bestand darauf, ihn freizulassen. „Lasst ihn doch gehen, er ist doch nur ein Unglücksvogel, der niemandem je ein Leid zugefügt hat.“ Mein Väterchen hatte recht. Farina war ein Mensch, der sich begeistern ließ und dann mit Eifer sein Ziel verfolgte, aber er war nicht etwa ein böser Mensch! Die Partisanen aber, nach einer Weile, als sie sahen, dass Väterchen den Farina so sehr verteidigte und sich für ihn einsetzte, wurden ungeduldig und drohten jetzt auch ihm mit den Worten: „Wenn du so sehr darauf bestehst, dass wir ihn freilassen, dann heißt das, dass du so bist wie er und auf seiner Seite stehst. Wir machen jetzt kurzen Prozess mit dir und auch du kommst mit uns“, und sie richteten den Gewehrlauf auf ihn.
Zum Glück war Väterchen nicht allein, sondern mit Altero, denn wer weiß, wie die ganze Geschichte sonst geendet hätte. Als er sah, dass die Partisanen Väterchen ergriffen hatten und abführen wollten, war er sofort zur Stelle, um einzugreifen: „Was soll das? Ihr seid ja wohl nicht bei Sinnen. Lasst ihn los, was habt ihr euch nur in den Kopf gesetzt? Der kommt euch doch nicht in die Quere. Der trägt doch nur die Post aus und ist dazu noch Antifaschist, sogar ein ganz überzeugter.“ Gottseidank hörten sie auf Altero und ließen sich von ihrem Vorhaben abbringen. In Cetica war er allen bekannt, denn er war der Hufschmied und ganz bestimmt kannten auch sie ihn. Und so konnte Altero sie letztendlich überzeugen und sie ließen Väterchen gehen.
Vergeltungsschläge
Nach jedem Angriff oder Gewehrfeuer der Partisanen auf deutsche Stellungen verteidigten sich die Deutschen, indem sie die Gegenden nach Partisanen durchkämmten und die Häuser in Brand steckten. Auch wenn es immer nur die Partisanen waren, die mit den Schießereien begonnen hatten, so richteten sich die Vergeltungsschläge der Deutschen gegen alle, weil die Partisanen ihre Angriffe aus dem Hinterhalt unternahmen und sich versteckt hielten. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Capezzi, von wo aus die Partisanen auf die Deutschen schossen, und als diese dann das Feuer erwiderten, verließen die Partisanen fluchtartig ihr Versteck. Als die Deutschen dann dort oben ankamen, war der ganze Ort wie ausgestorben, alle hatten die Flucht ergriffen aus Angst vor Vergeltungsschlägen und das war gut so, denn hätten sie dort jemanden angetroffen, der wäre mit seinem Leben bestimmt nicht davongekommen, und so wurde zur Vergeltung alles niedergebrannt. Während des Feuergefechtes war Stella jedoch verwundet worden, und unüberlegterweise brachten sie ihn ins Krankenhaus nach Poppi. Dort waren allerdings auch die Deutschen, und als sie herausfanden, dass sie es waren, die ihn im Feuergefecht verwundet hatten, wurde er abgeführt, nach Campaldino gebracht und nahe dem Fluss mit noch anderen Partisanen erschossen. Wie ich dir bereits andeutete, hatten die Deutschen als Vergeltungsmaßnahme eine Razzia gemacht und eine Gruppe von Leuten gefangen gehalten, die dann aber glücklicherweise wieder freigelassen wurden, dank der Fürsprache und der geschickten Verhandlungstaktik von Don Bozzo.
Ich selbst befand mich auch einmal in der Situation, ein Attentat zu verüben, und zwar in der Nähe von Strada bei der Riobrücke, wo immer ein gepanzertes Fahrzeug stand. Eines Abends gingen wir los, Richtung Brücke und versteckten uns unter der Brücke, ich, Cicalino und noch andere aus Strada, bewaffnet mit zwei, vielleicht waren es auch drei, Handgranaten. Die wollten wir auf das Fahrzeug schleudern, wir wollten uns halt groß tun und irgend etwas unternehmen. Aber am Ende wurde doch nichts mehr aus alledem, denn Lisa, die Mutter von Clara, bat uns inbrünstig, die geplante Aktion abzubrechen, da sie fürchtete, man würde ihr Haus am Pizzico niederbrennen. Letztendlich konnte sie uns überzeugen, und wir ließen von unserem Vorhaben ab, aber trotz alledem wurde ihr Haus Opfer einer Vergeltungsmaßnahme, denn wenige Tage später wurde es in Brand gesteckt, um den Tod eines deutschen Soldaten zu sühnen, der nahe der Riobrücke in einen Hinterhalt der Partisanen geraten war. Auch in Prato, wo die Partisanen auf ein Motorrad mit Beiwagen schossen, wurden zur Vergeltung mehrere Häuser niedergebrannt.
Zur Abschreckung und Verteidigung gegen die Angriffe der Partisanen wurden die Vergeltungsschläge immer mehr intensiviert. In Pratarutoli und Cetica gab es bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen mit Partisanen und Bevölkerung, und es waren diese beiden Ortschaften, die zum Schauplatz einer der härtesten und grausamsten Vergeltungsschläge wurden, und zwar seitens der Deutschen und der Faschisten. Dies alles geschah am 29. Juni, am Tage von Sankt Peter und Paul. Am Tage zuvor hatten die Partisanen Farina getötet, und dies war sicherlich mit ein Auslöser für diese Vergeltungsaktion, die aber hauptsächlich deshalb unternommen wurde, um wiederholte Attacken der Partisanen zu vergelten. Diese hatten wenige Tage zuvor zwei deutsche Soldaten bei der Riobrücke aus dem Hinterhalt überfallen und getötet, zwei Deutsche, so schien es, die eine Binde mit Rotem Kreuz am Arm trugen. Die Reaktion auf diesen Anschlag, was konnte man anderes erwarten, kam prompt und an diesem 29. Juni wurde hart zurückgeschlagen und mehrere Personen kamen zu Tode. An dieser Strafexpedition beteiligten sich, das war mir klar, ebenfalls die Faschisten. Der Gegenschlag nahm seinen Anfang in Pagliericcio, und das erste Opfer wurde Grifoni, der es nicht schaffte, rechtzeitig in sein Haus zu flüchten. Auf andere Personen wurde entlang der Straße geschossen, auf Municchi, einen Vater mit seinem 15-jährigen Sohn, und in Pratarutoli gab es weitere fünf Tote. Dort wurden auch Häuser angezündet. Das nächste Ziel der Strafexpedition war das Bergdorf Cetica, und dort oben kamen mindestens zehn Personen im Feuergefecht mit den Deutschen ums Leben. Zwei oder drei dieser Getöteten kamen aus Cetica, und gottseidank konnten fast alle Einwohner rechtzeitig flüchten und sich in Sicherheit bringen, weil der Lärm der ersten Schüsse in Pagliericcio und Pratarutoli sie alarmiert hatte. Die anderen Opfer waren Partisanen, die versucht hatten, sich zu verteidigen. Weiterhin wurden viele Häuser in die Luft gesprengt und angezündet, aber die Häuser der Faschisten, nur wenige in Cetica, blieben verschont und unversehrt. Wie erklärst du dir das also, dass man die Häuser der Faschisten von allen anderen unterscheiden konnte, wenn nicht durch die Faschisten selber, die aus der Gegend stammten und gemeinsam mit den Deutschen die Strafaktion durchgeführt hatten? Am Abend des gleichen Tages wurden die Deutschen, während sie sich auf dem Rückweg nach Strada befanden, in der Nähe der Brücke von Pagliericcio, abermals von den Partisanen überfallen und es gab viele Tote.
Meine Mutter ging am Tag darauf zu Fuß nach Cetica, weil sie fürchtete, meinem Bruder Giannetto, der, das wusste man, auf der Seite der im Pratomagno operierenden Partisanen stand, könnte etwas zugestoßen sein. Dort oben angekommen erfuhr sie, dass er sich nicht da aufgehalten hatte, aber als sie zurückkam, waren ihre Haare, ob der grausamen Szene, die sich ihren Blicken geboten hatte, in einem Nu grau geworden. In den Tagen darauf, bevor der Rückzug Richtung Norden begann, wurden eine Menge Häuser in Prato, Rifiglio, Pagliericcio und anderen Gegenden in Brand gesteckt und vermint, und viele weitere unschuldige Menschen, wie auch in Montemignaio, kamen ums Leben. Während des Rückzugs wurden dann alle Brücken vermint und zerstört. Hier in dieser Gegend blieb, soviel ich weiß, nur die romanische Brücke von Cetica unversehrt.
Bombenangriff auf die Häusergruppe “ Casa Patriarca ” 13 Häuserkonglomerat, das sich beiderseits der Durchgangsstraße gruppierte, ganz nahe dem Fluss Solano.
Die Bombardierung der Häusergruppe Casa Patriarca geschah am 25. Juli 1944, und einer der ersten, die zu Hilfe eilten war Don Bozzo und kurz danach war auch Alfredo, dein Vater, zur Stelle. Zu dem Zeitpunkt, als die Bomben niedergingen, war er unterwegs auf einem schmalen Waldweg ins Dorf Garliano, diesseits des Flusses und als er sah, was geschehen war, durchquerte er in aller Eile den Fluss, um Hilfe zu leisten. Diese Bombardierung sollte gezielt das Haus von Sabatini, das direkt am Solano gelegen war, zerstören, weil hier eine Kommandostelle der deutschen SS stationiert war: Gewiss hatte jemand den Amerikanern einen Hinweis gegeben. Diese Bomber verfehlten jedoch ihr Ziel und nur wenige der abgeworfenen Bomben trafen zufällig ins Ziel. Eine große Bombe, die nicht explodiert war, hatte man im Fluss gefunden, die meisten anderen fehlgelenkten schlugen in das Haus von Folli ein, auf der anderen Straßenseite. Dieser Bombenangriff kam aus heiterem Himmel und ganz unerwartet und so konnten sich die Bewohner nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und Schutz in ihren Kellern suchen. Dieser Bombenhagel forderte wieder unschuldige Menschenleben, es starben zwei Kinder von Folli, Cecilia und ihr jüngster Bruder Pietro, und die Hausangestellte mit ihrem Sohn. Giovanni Folli erlitt eine Handverstümmelung, während seine Mutter und seine Tante Antonietta unverletzt blieben.
Deportiert
Es war der 6. August 1944, an einem Sonntag, als wir von den Deutschen abgeholt wurden. Und zwar als Folge einer Bekanntmachung, dass alle Männer im Alter von 18 bis 60 sich zum Arbeitseinsatz zu melden hätten, und das hieß im Klartext: zum Arbeitsdienst nach Deutschland. Wir, die wir uns melden mussten, wussten nicht, wie wir uns verhalten sollten, und so gingen viele Ratsuchende zu einem der Dorfältesten, namens Giulio Luzzi, den man wegen seines Alters in Ruhe ließ, und holten sich bei ihm Rat.
An dem gleichen Sonntag ging auch ich zu ihm, aber er winkte ab und gab mir zu verstehen, nicht reinzukommen, da er schon mit anderen Leuten beschäftigt war. Ich bedeutete ihm mit einer Kopfbewegung, dass ich mein Fahrrad oben in sein Dachstübchen stellen wollte und er verstand sofort, was ich meinte, nämlich, dass ich mich dort oben versteckt halten wollte. Mit einem Kopfnicken gab er sein Einverständnis. Das Fahrrad stellte ich also nach oben, aber ich selbst blieb nicht dort, und das war totaler Schwachsinn, denn wäre ich an dem Tag dort im Versteck geblieben, hätten sie mich nicht gefunden. Ich wartete da also vor dem Haus von Giulio, um mit ihm reden zu können, als Saul vom Marktplatz auf mich zukam und mich fragte: „Hallo Gilberto, die Deutschen sagen, wir sollen uns melden. Was meinst du sollen wir tun, uns melden oder nicht?“ Man musste zur Ferrea gehen und dort vorstellig werden, und zusammen mit allen anderen musste man dann in einem abgeteilten Gelände warten. Und wir, gleich zwei Dummköpfen, gingen letztendlich hin. Man behielt uns natürlich dort, und anschließend wurden wir alle nach Porrena gebracht!
Hier in Strada wurden viele Personen zusammengetrommelt, an die 150, und zusammen mit denen, die man am Tag zuvor aus Garliani, Cetica, Pagliericcio und anderen Dörfern mitgebracht hatte, wurden wir alle auf diesem abgegrenzten Gelände festgehalten. Schon frühmorgens hatten sie sich an zwei getarnten Punkten, Collegino und Casaricciolino, mit ihren Spähfahrzeugen in Stellung gebracht. Alle die ins Dorf gingen, ließ man unbehelligt, aber danach nahm man sie fest und brachte sie unten aufs Gelände. Auch die in aller Frühe, um halb sieben, ahnungslos zum ersten Gottesdienst gingen, wurden danach mit aufs Gelände genommen.
Diese Geschehnisse in Strada kommentierte Cesario14 Cesario Ceruti war ein Freund von Gilberto und wurde mit allen anderen nach Deutschland deportiert. In einem kleinen Tagebuch hatte er alle Geschehnisse aufgezeichnet, die sich seit seiner Gefangenschaft bis zur Asylgewährung in einem amerikanischen Feldlager abgespielt hatten. Die beschriebenen Begebenheiten, die die ersten 28 Seiten seines Buches ausfüllen, stimmen inhaltlich mit den Erinnerungen, wie sie Gilberto niedergeschrieben hat, überein. Das Tagebuch befindet sich jetzt im Besitz von Gianni Ronconi. Wann immer in dieser Schrift auf das Tagebuch hingewiesen wird, wird es in Schrägschrift als Tagebuch bezeichnet, mit Seitenangabe. wie folgt: „Wir verließen Strada und hatten uns der Illusion hingegeben, einen vorläufigen Arbeitsplatz in der Gegend von Stia angeboten zu bekommen. Statt in Richtung Stia zu fahren, wurden wir per Lastwagen und einige auch zu Fuß zum Weinkeller von Pietro Vettori nach Porrena gebracht. Und Cicalino? Der hat sich wirklich dumm verhalten. Er konnte zwar entkommen und zurücklaufen nach Hause, aber statt ins Haus zu flüchten und sich versteckt zu halten, vergeudete er kostbare Zeit, indem er seine Frau umarmte und küsste, und als sie ihn sahen, wurde er von den Deutschen ein zweites Mal festgenommen und zurück nach Porrena gebracht. Nach etwa zwei Stunden mussten wir ein zweites Mal in die Lastwagen steigen und die Kolonne setzte sich in Bewegung Richtung Pratovecchio und Stia. Als wir durch Pratovecchio fuhren, hat jemand den Sprung vom Lastwagen gewagt und hat sich unter die Menschenmenge gemischt, um nicht erkannt zu werden. Aber nur wenige wagten den Sprung in die Freiheit, aus Angst man würde ihnen hinterherschießen.
Als wir dann den Calla-Pass hinauf fuhren, kam es vielen von uns in den Sinn, in einer der Haarnadelkurven die Flucht zu ergreifen, als wir dann aber unter uns darüber berieten, war da immer irgend jemand, der sich mit lauter Stimme Gehör verschaffte und dagegen protestierte, weil man Vergeltungsschläge gegen Familienangehörige fürchtete. Im Lastwagen, in dem ich saß, war nur ein Wachmann, ein einziger, der seitlich auf einem Hocker saß. Einer sagte: „Jetzt in der Kurve versetzen wir ihm einen Stoß und dann flüchten wir. Es hätte genügt, und wäre ein leichtes gewesen, ihm einen Schubs zu geben, sodass er bestimmt hinuntergestürzt wäre und wir so alle mit Leichtigkeit hätten flüchten können. Ich weiß noch, dass Nello Ferrantini und Fiocco die treibenden Kräfte waren und diesen Fluchtplan unbedingt ausführen wollten. Hätten die anderen eingewilligt, dann hätte sie nichts mehr aufgehalten, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Aber die älteren unter ihnen waren dagegen und wollten nicht mitmachen, aus Angst vor den Folgen: „Nein, nein, halt, stopp. Das kann nur schief gehen. Wenn wir uns auf dieses Abenteuer einlassen, wird man alle unsere Häuser in Strada in Brand stecken.“ Die anderen, die dafür waren und die Flucht versuchen wollten, erwiderten: „Lasst es uns versuchen, wir sind viele und so können sie unseren Herkunftsort schwer ausfindig machen.“ Wir waren nämlich eine bunt durcheinandergewürfelte Gruppe aus verschiedenen Orten wie Poppi, Stia, Bibbiena, Ortignano und anderen Gegenden des Casentinos. Unter denjenigen, die sich jedem Versuch der Überredung widersetzt hatten, waren auch drei Väter mit ihren Söhnen: Emilio Paggetti mit seinem Sohn Aldo, dann Guido Francioni mit Mauro, und Buzzino mit Silvano. Alle waren dagegen und widersetzten sich, weil sie Schlimmeres fürchteten. Nach all dem Palaver wurde der deutsche Wachmann stutzig und ahnte, dass wir irgend etwas im Schilde führten und so richtete er sich augenblicklich auf, hielt sein Gewehr im Anschlag und brüllte uns an, um uns Angst einzujagen und sich selbst stark zu machen, denn das Komische an der ganzen Geschichte war, dass er mehr Angst vor uns hatte als wir vor ihm. Obwohl er bewaffnet war und wir nicht, fürchtete er mehr unsere Überzahl als wir seine Waffe, und das war eine gefährliche Situation, denn mit dieser Angst im Bauch hätte leicht mal ein Schuss losgehen können, und soweit wollten wir es nicht kommen lassen, und deshalb gaben wir letztendlich alle unsere Fluchtpläne auf.
Nach einer gewissen Fahrtzeit trafen wir in Forlì ein, und für viele von uns hatte die abenteuerliche Fahrt dort ein Ende, denn ein Sergeant aus Bibbiena, der in Forlì stationiert war, brauchte Leute für die Todt, um am Mandrioli-Pass zu arbeiten. Sie mussten dort zwar für die Deutschen arbeiten, aber dort oben im Gebirge seinen Dienst zu tun, war auf jeden Fall angenehmer, als nach Deutschland gebracht zu werden. Auf dem Weg zum Mandrioli-Pass hatten dann einige die Gelegenheit wahrgenommen, sich von der Gruppe zu entfernen, davonzulaufen und zurück nach Hause zu gelangen. Unter diesen waren auch Ovidio Francioni, Assuero Colozzi, Danilo Grifagni und noch einige andere. Wir, die übriggebliebene Gruppe, setzten unsere Fahrt fort in Richtung Norden, immer in der gleichen deutschen Lastwagenkolonne. Dann kamen wir nach Bologna, durchquerten die Stadt und sahen überall eine Vielzahl von Menschen. Um diese ahnungslosen Leute zu warnen, riefen wir ihnen zu: „Lauft weg, lauft davon und bringt euch in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Wenn sie euch kriegen, nehmen sie euch mit!“, aber man hörte nicht auf uns, und jeder ging unbekümmert weiter seines Weges, als wenn nichts geschehen wäre, sie glaubten uns wohl nicht. Wer weiß, wie es vielen von ihnen ergangen sein mag. Den meisten wird Ähnliches wie uns widerfahren sein, denn aus ganz Italien wurden die Leute zum Arbeiten zusammengetrommelt, d. h. deren man habhaft werden konnte, und in den Norden gebracht.
Am 10. August kamen wir in Verona an, wo man uns aussteigen ließ und in ein Schulgebäude führte, das über eine doppelte Außentreppe erreichbar war. Während wir die Stiegenrampe hinaufgingen, kamen auf der Rampe gegenüber andere Leute herunter und in der Gruppe befand sich auch Altero, der Bruder von Bubbone. Ohne ihn überhaupt gesehen zu haben, rief ich ihm zu. Und er, während er die Stufen hinunterging, war ganz überrascht, dass ihn jemand erkannt hatte und erwiderte: „Wie hast du mich nur erkannt in dieser Menschenmenge?“ „Ja, wie wohl? Ich hab dich singen gehört.“ Altero war eine Frohnatur und war fast immer am Singen, nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten, denn man konnte nicht behaupten, dass seine augenblickliche Lebenslage zum Singen Anlass gab. Dennoch war ihm zum Singen zumute und er sang und sang und sang immerzu, er hatte nun mal diese Angewohnheit. Ich hätte seine Stimme ganz bestimmt aus tausend Stimmen herausgehört, und so geschah es denn auch, ich hörte ihn, erkannte ihn augenblicklich und rief ihn herbei. Und er: „Gilberto, Gilberto, wir sind abgeholt worden zum Arbeitsdienst, man hat uns gesagt, wir würden gebraucht, um gewisse Arbeiten zu verrichten.“ Man hörte allerdings aus seiner Stimme, dass er von der Sache nicht ganz überzeugt war, und dem Frieden nicht traute. Seine dunkle Vorahnung sollte sich bewahrheiten, denn er wurde nach Österreich geschickt. In Verona bestiegen wir einen Zug, der sich in Richtung Venedig in Bewegung setzte. In Venedig angekommmen, machten wir eine Pause. Da sie uns unsere Kennkarten abgenommen hatten, durften wir aussteigen und den Zug verlassen, sogar in Begleitung eines Carabiniere einen Spaziergang durch Venedig machen, denn ohne Papiere konnten wir uns nicht ausweisen, und da wir bewacht waren, auch nicht die Flucht ergreifen. Danach ging es weiter nach Treviso, und dort mussten wir umsteigen in einen Güterwagen. Und da wurde uns spätestens klar, dass die Fahrt nach Deutschland ging. Am 12. August trafen wir in Villach ein, und von dort ging es geradewegs nach Köln.
Gefangenenlager
Von Köln fuhren wir dann mit dem Zug rheinaufwärts, während alle anderen auf andere Gebiete in Deutschland verteilt wurden. Die, die rheinaufwärts fuhren, befanden sich, so schien es, in einer besseren Lage als die anderen, obwohl viele dieser zweiten Gruppe zur Arbeit bei den Bauern abkommandiert wurden. Schlechter hingegen erging es Sandro Lorenzoni, Tito Focacci und Natalone, die in ein Lager gebracht wurden, wo es wenig zu essen gab, aber hart gearbeitet werden musste. Sie mussten vierzehn, fünfzehn Stunden am Tag Zwangsarbeit leisten. Sandro erzählte mir immer von seinen Erlebnissen in dieser schrecklichen Zeit. Jeden Tag fand man irgendwo einen Toten, der an Hunger, Schwäche oder Krankheit gestorben war. Mir fällt gerade noch ein Erlebnis ein, von dem er mir erzählte: Mit noch anderen Deportierten waren sie am Arbeiten auf einem Dach und beobachteten, wie unten ein toter Hund begraben wurde. Sobald sie vom Dach heruntersteigen konnten, rannten sie zu der Stelle, wo der Hund begraben lag und gruben ihn aus. Danach brachten sie ihn mit ins Lager, besorgten sich einen Kessel und kochten den Hund drei oder vier Tage lang, um ihn danach zu verzehren. So ausgehungert waren die Leute! Die meisten Leute, die das Lagerleben mit ihm teilten, und diejenigen, die in anderen ähnlichen Lagern lebten, starben wegen Essensmangel an der Ruhr, es gab nur Steckrüben und warmes Wasser. Dort starben auch der Buckelige aus Bulletta und ein Angehöriger der Familie Bargellini.
Am 19. August 1944 wurden wir, ich, Cesario Ceruti, Niccolino Ceruti und Walter Donatelli, ins Lager 3 nach Oppau bei Ludwigshafen gebracht, in die Nähe eines Industriegebietes. Wir waren fast immer zusammen geblieben, und mit in unserer Gruppe war am Anfang auch Guido Moretti, aber sein Arbeitsplatz war weit von uns entfernt, und so trafen wir ihn nur einige Male. Am 23. September begann unser erster Arbeitstag in der Badischen Anilik- und Sodafabrik; dorthin kehrte ich dann nach mehr als zwanzig Jahren nochmal zurück, zusammen mit Francesco und Guido. In der Fabrik wurde zwar gearbeitet, aber wir brauchten uns nicht vor lauter Arbeit umzubringen. Das was wir machen mussten, war verhältnismäßig leicht, denn die Deutschen überließen die schwere Arbeit den gefangengenommenen Soldaten, die in großer Zahl dort ihren Arbeitsdienst leisten mussten. Als wir dort ankamen, wurden wir in Baracken untergebracht, die gar nicht so schlecht waren. Es gab sogar kaltes und auch kochendheißes Wasser, das aus der Fabrik in Leitungen verfügbar war, und wir hatten sogar Duschen und Waschbecken. Unser Lager war nicht eingezäunt mit Drahtverhau, sondern nur mit einem Holzlattenzaun umgeben, und es wäre ein leichtes gewesen zu entkommen. Nur, wohin hätte man gehen sollen? Außerdem ging es uns dort ziemlich gut, und so kam eigentlich keiner auf die Idee, sich aus dem Staub zu machen. Und obendrein wurden wir auch noch bezahlt, ich glaube wir bekamen 50 Mark am Tag.
Am 30. August begannen die Bombenangriffe, es waren meistens englische Bomber, die fast immer nachts kamen und zuerst das zu bombardierende Gebiet mit Leuchtteppichen erhellten, die heller waren als diese Lampe hier, und anschließend ihre Ziele bombardierten. Es war so hell erleuchtet, dass man eine Stecknadel hätte finden können. Während der ersten Bombardierungen kamen sie auch einmal tagsüber, als wir in der Fabrik bei der Arbeit waren. Es gab Fliegeralarm, wir ließen alles stehen und liegen und eilten in den Luftschutzraum, der eigens für die Fabrikarbeiter innerhalb des Fabrikgebäudes gebaut worden war. Wir hatten den Schutzraum noch nicht erreicht, als wenige Meter von uns eine große Bombe einschlug. Gottseidank war es ein Blindgänger, sie explodierte nicht, denn wenn sie hochgegangen wäre, säße ich jetzt nicht hier, um dir meine Geschichte zu erzählen; wir hatten diesmal mächtig Glück gehabt. Wir sollten wohl vom Schicksal noch verschont bleiben, und so konnten uns die Bomber nichts anhaben. Diese Tatsache bestärkte mich in meinem Glauben, dass wenn meine Zeit noch nicht gekommen ist, ich auch ohne Schutzraum unversehrt bleiben kann. Und so hatte ich es, wenn die Sirenen heulten, nicht mehr so eilig, mich in Sicherheit zu bringen und folgte den anderen mehr gemächlich als hastig in den Luftschutzkeller. Als wieder einmal Fliegeralarm war, wollte ich ungeschützt in meiner Baracke bleiben, auch weil der Luftschutzraum keinen ausreichenden Schutz vor großkalibrigen Bomben bot. Er hatte nur einen Splitterschutz, bogenförmig aus Zement, und die Leute konnten wohl vor kleineren Bomben sicher sein, aber nicht vor 500 kg schweren. Deshalb war es für mich gänzlich unnütz, mich da in so einem Leichtbaubunker in Sicherheit zu bringen. Außerdem konnten mir die Bomben ja nichts anhaben, die explodierten erst gar nicht in meiner Gegenwart. Cesario und die anderen riefen mir zu, dass ich mich beeilen solle, aber ich blieb, wo ich war. Ich hörte weiter ihre Rufe: „Mach schnell, beeil dich, die Bomben fallen schon...!“ Ganz zuletzt entschied ich mich doch, rannte zu den anderen und stürzte in den Schutzraum. In demselben Augenblick explodierte eine Bombe ganz in unserer Nähe, sodass mich der Luftdruck gegen die im Schutzraum stehenden Menschen schleuderte. Nach dem Luftangriff gab es Entwarnung, wir konnten unseren Bunker verlassen und gingen nach draußen und die Baracke, in der ich eben noch war und in der ich den Bombenhagel überstehen wollte, war vom Erdboden verschwunden. Es musste also doch wohl wahr sein, dass irgendwo geschrieben stand, dass die Bomben mir nichts anhaben können.
In der Folge hatten wir uns mit einem weiteren Problem auseinanderzusetzen. Ab und zu kamen die Soldaten, nahmen jemanden mit, aber nicht immer kam er zu uns zurück, sondern wurde anderswo eingesetzt. Eines Abends holten sie auch Niccolino und Walter ab und nahmen sie mit sich. Sie wurden an der Arbeitsfront eingesetzt, um die Panzerabwehrgräben zu schaufeln, denn die Amerikaner waren nicht mehr weit und rückten immer näher heran, und deshalb holten sich die Deutschen die Leute aus den Lagern für den Arbeitseinsatz an der Front. Die Angst, eines Tages abgeholt zu werden, überkam uns immer mehr, und wir mussten unbedingt aus dieser Situation einen Ausweg finden, um wenigstens in Ruhe schlafen und unsere Arbeit verrichten zu können. Zum Glück kam mir ein rettender Gedanke.
Mein Vorgesetzter in der Anilikfabrik hieß Gofman. Das war ein ehrlicher Mensch, auch Nazigegner soviel ich weiß, sonst wäre er uns gegenüber wohl nicht so hilfsbereit gewesen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wenn er sein Essen holte auf einem Speisetablett mit zusätzlich einer ihm zugeteilten Portion Fleisch, er etwas von dem Fleisch aß und mir dann zu verstehen gab: „Hier, iss du auch etwas davon.“ Das Essen war allerdings im Moment kein drängendes Problem, auch wenn die uns zugeteilte Ration nicht gerade üppig war. Wir arbeiteten die ganze Woche hindurch, und am Samstag wurde uns von den Fabrikbesitzern eine Bescheinigung ausgestellt. Mit diesem Schein, der bezeugte, dass wir unsere Arbeitspflicht erfüllt hatten, ließen wir uns beim zuständigen Büro Lebensmittelkarten für die ganze Woche aushändigen. Diese Karten mussten wir dann täglich einlösen, um unsere Ration zu bekommen. Wenn sie nicht eingelöst wurden, verfielen sie.
Gofman war sehr entgegenkommend und tat mir viele Gefallen, und deshalb wollte auch ich ihm einen Gefallen tun. Er hatte eine Waage, ähnlich einer Apothekerwaage, ein ganz besonderes Präzisionsinstrument, das die Form eines Fernglases hatte, mit dem er den Rohnickel wog, der in der Fabrik verarbeitet wurde. Der Nickel wurde zuerst vorsichtig zerkleinert und immer mehr zerrieben, bis er wie Kies wurde, dann wurde er nochmals weiter zerrieben, sodass er zuletzt fast pulverförmig wurde, und in diesem Zustand wurde eine kleine Menge mit dieser Waage gewogen. Als ich ihm wieder mal begegnete, ließ ich ihn wissen, dass ich ein kleines Kästchen für seine Waage anfertigen wollte, um sie besser tragen zu können und vor Beschädigungen zu schützen. Er stellte mir also einen Schein aus, mit dem ich das Material für das Kästchen von einer Tischlerwerkstatt in der Nähe besorgen konnte; und so bastelte ich ihm also ein schmuckes Holzkästchen mit einem Tragegriff, als Aufbewahrungsort für sein kostbares Präzisionsinstrument, das er getrost von einem Ort zum anderen tragen konnte, wann auch immer es gebraucht wurde. Damit die Waage nicht hin und her rutschen konnte, hatte ich in die Wandung mehrere Nuten gefräst, sodass die Waage ganz fest saß und fast von allein in das Kästchen rutschte wie auf einer Gleitschiene. Als alles fertiggestellt war und ich ihm das handgefertigte Produkt übergab, war er hocherfreut und bedankte sich immer wieder: „Oh, gut, wunderbar, danke schön, ganz vielen Dank.“ „Du machst da all die Sachen für den Deutschen da“, sagten mir die anderen. Die wollten einfach nicht verstehen, dass uns allen das Leben etwas erleichtert wurde, wenn wir ihm wohlgesonnen waren und wenn nötig auf seine Hilfe zählen konnten.
So, um nun noch mal auf das vorige Thema zurückzukommen: Wir waren ziemlich beunruhigt, dass man auch uns eines Tages abholen und mit an die Front nehmen würde. Und so ging ich zu Gofman und sagte ihm: „Allabendlich kommen die Soldaten in unsere Schlafsäle und nehmen jemanden mit. Gäbe es da nicht einen Ausweg, um das zu verhindern? Was könnte man da unternehmen, damit wir hier sicher sind und nicht auf Abruf bereitstehen müssen?“ Als Antwort auf die geäußerten Sorgen und um uns zu helfen, hatte er Folgendes ausgeklügelt: Er beschaffte mir einen Sonderausweis, d. h. eine Bescheinigung, die vom Chef ausgestellt wurde und besagte, dass meine Arbeit für die Produktion in der Fabrik unentbehrlich wäre. Dieser Sonderausweis sah so aus wie der Ausweis, der uns bei unserer Ankunft ausgehändigt wurde, mit Foto und Nummer, ich war die Nummer 929 wie auf dem Foto ersichtlich. Nachdem ich mich bedankt hatte, sagte ich ihm noch: „Ich nehme dieses Dokument dankbar an, aber was wird aus meinen Arbeitskameraden? Wenn die nicht gleich behandelt werden, dann muss ich auf die mir gewährte Vergünstigung verzichten, dann kann ich sie nicht annehmen. Wir sind immer zusammen gewesen und haben immer zusammengehalten, ich kann sie jetzt nicht im Stich lassen während ich selbst in Sicherheit bin.“ Ich wollte auch Cesario und die anderen, die zur Zeit anderswo arbeiteten, in Sicherheit wissen. Er sah das ein und stellte mir auch für Cesario einen Sonderausweis aus, und ich bin mir sicher, dass er Niccolino und Walter ebenfalls mit einbezogen und gleich behandelt hätte, aber die beiden waren vorläufig auf einer anderen Arbeitsstelle, und so konnte er für sie nichts tun. Gofman war wirklich ein guter und hilfsbereiter Mensch. Diese Sondergenehmigung, die er uns verschafft hatte, war sehr nützlich, denn wir hatten uns damit gewisse Vorrechte erworben. Wenn zum Beispiel die Soldaten kamen, und ich weiß noch, eines Abends kam auch die Polizei, zeigten wir diese Sonderausweise, und wir wurden prompt in Ruhe gelassen. Man sagte uns nur: „Geht schlafen“ und wir konnten da verbleiben, wo wir waren.
Wir versuchten immer so gut wie eben möglich durch den Tag zu kommen und nutzten jede Gelegenheit, unseren Aufenthalt im Lager und auf dem Arbeitsplatz so erträglich wie möglich zu gestalten. Ich hatte ein Stück Leinentuch gefunden, mit dem ich mir eine Art Rucksack bastelte, den ich immer bei mir trug und mit einer Schnur zubinden konnte. Auch konnte ich mir drei Bettdecken durch Tauschgeschäfte besorgen, und eine andere Decke zerschnitt ich, um mir warme Socken daraus zu machen. Als man uns hierher brachte, hatte ich nur meine Leinensachen an, die mir aber immerhin als Muster dienten, um mir ein Paar wärmere Socken aus der Decke zu schneidern. Die zugeschnittenen Stücke nähte ich dann mit Metall- oder Kupferdraht zusammen. Diese selbstgebastelten Socken waren wirklich unschön, aber ich trug sie ja versteckt unter der Arbeitskleidung, die man uns gegeben hatte, und die Hauptsache war ja, dass sie mich wärmten. Ich hatte auch ein Paar schöne Schuhe, zum Wandern im Gebirge geeignet, und immer wenn ich mich in meine Koje schlafen legte, zog ich sie aus und legte sie als Kopfkissen unter meinen Kopf und verkroch mich unter die Decken. Und weshalb dienten mir die Schuhe als Kopfkissen? Damit sie mir keiner entwenden konnte!
Auch Walter ließ sich alles Mögliche einfallen, damit wir über die Runden kamen. Da die Nahrungsmittel immer knapper wurden, ging er immer auf Suche, um etwas Essbares zu finden, und zwar außerhalb des Fabrikgeländes in einem nahegelegenen Dörfchen. Einmal kam er mit einem Sack Mehl zurück, das war kurz vor Weihnachten, und wir machten uns damit Mehlklöße mit Würstel. Nach Weihnachten wurden Walter und Niccolino abermals abgeholt, und Cesario vermerkte das in seinem Tagebuch so:
Am 26. mussten sich die beiden für einen weiteren Fronteinsatz bereithalten und fuhren noch am gleichen Tage los. Nachdem sie ihren Brotvorrat aufgezehrt hatten, bot sich ihnen die Gelegenheit, die Flucht zu ergreifen und kamen zurück.15 Tagebuch, S. 7.
Das große Problem war jetzt, dass sie ohne Papiere waren, die hatten sie vor der Abfahrt zur Arbeitsfront den Deutschen übergeben müssen. Deshalb mussten sie ab jetzt sehr vorsichtig sein, um nicht aufzufallen und womöglich als Fluchtverdächtige enttarnt zu werden. Was die Situation noch weiter komplizierte, war die Tatsache, dass sie nicht nur ohne Papiere waren, sondern auch keinen Sonderausweis hatten, der nur Cesario und mir ausgestellt worden war, und so waren sie immer in Gefahr, von den Soldaten abgeholt zu werden. Als Folge dieser verzwickten Lage, in der wir uns befanden, kam noch ein großes Problem hinzu, das auschlaggebend war für unser Überleben, nämlich die Beschaffung der nötigsten Überlebensmittel:
In den Tagen, die folgten, waren wir ziemlich niedergeschlagen, denn wir hatten nur zwei Lebensmittelkarten, mussten aber für vier Mäuler sorgen... doch Gilberto hatte sich was einfallen lassen, dass uns in diesen tristen Stunden wieder etwas Mut einflößte. Wir fingen einen Handel an mit deutschen Keksen, die wir in Mannheim für wenig Geld einkauften und dann mit einem guten Gewinn wieder verkauften. 16 Tagebuch, S. 8.
Niccolino und Walter waren wieder einmal zum Einkaufen nach Mannheim gefahren, aber am Abend kam Niccolino ohne Walter zurück und sagte, dass Walter noch hätte dableiben wollen, um vielleicht noch einige günstige Einkäufe tätigen zu können, das jedenfalls war die offizielle Version von Walter. Seitdem war er spurlos verschwunden, und wir hatten nichts mehr von ihm gehört, und erst nach Kriegsende habe ich ihn wieder angetroffen. Und dann das liebe Geld, das brauchten wir natürlich, vor allem um zu überleben. Einmal kaufte ich von einem deutschen Mitarbeiter ein Kilo Brot für tausend Mark, die zu der Zeit den Gegenwert von etwa tausend Lire hatten. Ich blieb den ganzen Tag über ohne Essen, und das Brot hatte ich auch nicht angeschnitten, um zusammen mit Cesario und Niccolino davon zu essen, ein backfrischer und schön geformter Brotlaib, recht appetitlich. Nach ein paar Tagen war das Brot aufgezehrt, und ich kaufte ein neues von der gleichen Person. Aber diesmal kam er nach zwei oder drei Tagen zurück und sagte: „Du musst mir das Brot zurückgeben, das ich dir verkauft habe.“ Ich antwortete ihm ganz erstaunt: „Das Brot zurückgeben? Davon ist nichts mehr da, das haben wir bereits aufgegessen, ich und meine Kameraden.“ Ich hatte bis jetzt angenommen, dass er das Brot kaufte und dann weiterverkaufte, zumal er es mir gerne angeboten hatte. Aber dann fand ich heraus, dass er das Brot mit seinen Lebensmittelkarten kaufte und zuletzt, als die Karten alle verbraucht waren, hatte er weder Karten noch Brot. Auch für die Deutschen war alles rationiert, und denen ging es noch schlechter als uns.
Während dieser trostlosen und traurigen Zeit, hatte Cesario folgende schöne und ergreifende Worte in sein Tagebuch geschrieben:
Die Tage verstreichen und werden immer trostloser, die zu überwindenden Schwierigkeiten bleiben unüberwindbar. Das Essen, der Schlaf, als Grundbedürfnisse für uns Menschen, bleiben uns weitgehend versagt. Der Abend kündigt sich an und mit dem Abend die Nacht und mit der Nacht das Problem des Schlafes, wo soll man schlafen? Polizei, Wasser, Bombenangriffe, das sind die drei Dinge, mit denen wir uns beständig auseinandersetzen und konfrontieren müssen. Wir suchen, fragen, der Schlaf übermannt uns und unsere Angst, und wir entschließen uns kurzerhand und bereiten unseren Schlafplatz: ein Karton auf den Erdboden und eine dürftige Decke darüber, das ist das Notwendigste, um zu schlafen. Wir schließen unsere Augen, unzählige Gedanken gehen uns durch den Kopf, vor allem der Gedanke an unser Mütterchen, wir sehen in Bildern unsere Kindheit vorbeiziehen, jeder Augenblick unseres Lebens wird sichtbar und zieht wie ein Filmstreifen an uns vorüber, im Stillen gedenken wir dieser glücklichen Tage und erinnern uns an die Jugendzeit, aber auch an manch’ erlittene Trübsal. Und alsbald kehrt die raue Wirklichkeit in unsere Gedankenwelt zurück, liebste Eltern, die ihr zuhause seid, Mütter... Schluss damit, Schluss jetzt, versuchen wir doch an all das nicht mehr zu denken, ein Magenknurren macht sich wieder bemerkbar, lassen wir diese süßen Träume in weiter Ferne und überlegen nun, was wir morgen essen. Am besten, wir gehen ein paar Kartoffeln stehlen. Die Polizei würde aber auf uns schießen, und vielleicht wäre es sogar besser, mit einem Schlag zu sterben als so langsam dahinzusiechen. Wir sind ausgehungert, hätten wir nur einige Kartoffeln, aber angemacht mit Öl, etwas Salz, so wie bei Muttern zuhause. Die Gedanken an die Mutter sind einfach nicht auszulöschen, nur muss man sie fernhalten, um nicht unnütz zu leiden. Allabendlich schlafen wir mit diesen Gedanken ein, gleich einem Delirium, und der erholsame Schlaf verwandelt sich in einen Alptraum, bewaffnete Faschisten stellen uns nach, wir sind am Laufen gehindert und können nicht entkommen, wir hören viele Gewehrschüsse, werden aus dem Schlaf gerissen und, mein Gott, es wird tatsächlich scharf geschossen, wir müssen eiligst in den Bunker, wir laufen um unser Leben, in einer Nacht erhellt von Schüssen und Explosionen, völlig außer Atem und schwach auf den Beinen, und doch, wenn wir den Bunker erreichen, werden wir vielleicht unsere Eltern eines Tages wiedersehen können. Bleib nicht stehen, renn so schnell du kannst, der Bunker ist 200 Meter weit, beeil dich, ich kann kaum noch, vorwärts, wir sind gleich da. Zwei oder drei Stunden vergehen, eine Stunde vor Tagesanbruch gehen wir schlafen, und danach, müde und erschöpft gehen wir erneut zur Arbeit. 17 Tagebuch, S. 13-21.
Die Flucht aus dem Lager
Es gab fast keinen Tag, an dem nicht bombardiert wurde und eines Nachmittags wurde auch die Fabrik, wo ich am Arbeiten war, getroffen. Ein Teil des Fabrikgebäudes wurde zerstört und hier und da explodierten Brandbomben. Wir hatten uns rechtzeitig in Sicherheit gebracht und blieben in den Luftschutzräumen, die überall vorhanden waren. Nachdem der Bombenhagel vorbei war, machte ich mich sofort auf die Suche nach meinem neuen Rucksack mit den drei Decken, den ich in der Eile zurückgelassen hatte, und nun war ich sehr besorgt, dass er womöglich verbrannt war oder unter dem Schutt begraben lag. Also rannte ich sofort zum Fabrikgebäude, aber auch Gofman war aus seinem Unterschlupf hervorgekommen und eilte nun zur Fabrik und kam noch vor mir an in dem Raum, aus dem wir vor dem Angriff geflüchtet waren. Als ich ankam, sah er sofort, dass ich sehr besorgt war, aber mit einem zufriedenen Grinsen erklärte er mir: „Keine Aufregung. Mach dir keine Sorgen, denn dein Rucksack ist in Sicherheit, hab ihn gerade noch rechtzeitig rausholen können, bevor er verbrannte.“ Verstehst du jetzt wer Gofman war? Er wusste, wie wichtig der Rucksack für mich war. In unserer Notlage dachte jeder nur daran, sein eigenes Leben zu retten, Gofman hingegen dachte auch an seine Mitmenschen. Obwohl alle fluchtartig die Luftschutzräume aufsuchten, ergriff er vorher noch schnell meinen Rucksack, um ihn in Sichheit zu wissen. Im Grunde genommen war der Rucksack für ihn bedeutungslos, trotzdem hatte er ihn mir in letzter Minute vor den Flammen gerettet. Er war wahrlich ein guter Mensch, und ich war ihm wirklich wohlgesonnen wie ein guter Freund und deshalb habe ich ihn immer in tiefer Dankbarkeit und Verbundenheit in Erinnerung behalten.
Die Bombenangriffe auf diese Fabriken nahmen tagtäglich zu und an gewissen Tagen wurden wir bis zu viermal täglich bombardiert. Diese Angriffe begannen morgens gegen zehn, dann kamen sie zurück gegen Mittag und nochmals nachmittags gegen vier und nach einer vierstündigen Pause abermals abends zwischen acht und neun. Ich kann mich noch erinnern, dass man die Bomben der Engländer nicht herannahen hörte, und sie verfehlten selten ihr Ziel, hingegen die der Amerikaner kamen mit einem ohrenbetäubenden Getöse, aber nicht so zielgenau und schlugen nicht selten entfernt von uns irgendwo ein. Durch diesen anhaltenden Bombenterror war unsere Widerstandskraft weiter geschwächt worden, und so sagten wir uns: „Hier unter diesem Bombenhagel wird das Leben für uns unerträglich, wir müssen unbedingt weg von hier und auf einen Fluchtweg sinnen. Es wird auch immer schwieriger, uns mit Essen zu versorgen und einen Schlafplatz zu finden. Die Fabriken waren durch die Bomben fast alle zerstört worden, und die wenigen Gebäudeteile die noch standen, waren vom Einsturz bedroht. Das hatte zur Folge, dass wir uns nicht mehr auf unsere verschiedenen Arbeitsplätze verteilen konnten, sondern wir versammelten uns in den Räumen, die noch als verhältnismäßig sicher galten. Aber so viele Leute und so dicht gedrängt mit immer weniger Platz zur Verfügung, das konnte nicht gut gehen, und so entstand tagtäglich Streit und Zank. Dazu kam, dass Niccolino ohne Papiere war und sich nicht ausweisen konnte und folglich jederzeit abgeholt werden konnte. Aus dieser Situation gab es nur einen möglichen Ausweg, und wir alle waren uns einig: die Flucht. Wir schwebten hier sozusagen dauernd in Lebensgefahr und mit jedem Tag, der verging wurde die Gefahr größer. Also entweder jetzt und sofort weg von hier oder wir riskierten unser Leben.
Bei uns in der Fabrik war auch ein Marokkaner, der, ich kann mich noch erinnern, mit einer Französin verheiratet war. Er hatte sich eine kleine Hütte in der Nähe der Fabrik gebaut, mit einem Strohlager zum Schlafen und sogar ein kleines Öfchen hatte er sich zusammengebastelt. Als wir uns letztendlich für die Flucht als einzige Überlebenschance entschieden hatten, gingen wir zu ihm und machten einen Tausch: Wir gaben ihm unsere Lebensmittelkarten, die wenigen, die noch übrig waren, und er ließ uns dafür eine Nacht in seiner Hütte schlafen. Von dort konnten wir nämlich im Dunkeln besser entkommen, ohne gesehen zu werden. Bei Nacht aus dem Fabrikgebäude zu schleichen wäre riskant gewesen. Als wir bereit waren, gingen wir also am Abend vorher in die Hütte, um dort einige Stunden zu verweilen und zu schlafen und um dann im richtigen Moment die Flucht zu wagen. Es war bitterkalt, aber mit dem kleinen Öfchen konnten wir uns etwas aufwärmen und für die Nacht hatten wir es uns einigermaßen gut eingerichtet. Außerdem hatte ich immer meine drei Decken bei mir, und wenn ich mich richtig darin eingerollt hatte, konnte ich wenigstens etwas schlafen.
Am darauffolgenden Morgen, in aller Herrgottsfrühe, es war noch stockdunkel, nahmen wir unsere Siebensachen und schlichen uns davon. Nach nur hundert, zweihundert, vielleicht auch mehr Metern, ich weiß nicht mehr genau, kamen wir an einen Fluss, von dessen Existenz wir nichts wussten, und als wir sahen, dass das Wasser abwärts strömte, zogen wir diese logische Schlussfolgerung; „Wenn das Wasser abwärts strömt, müsste die Schweiz in der entgegengesetzten Richtung liegen. Wir gehen also stromaufwärts in der Hoffnung, dass die Schweiz nicht allzu fern ist.“ Wir gehen forschen Schritts die ganze Nacht hindurch, ich, Cesario und Niccolino, die ganze Nacht, ohne Pause die ganze Nacht, dann wurde es langsam hell, und wir waren immer noch am Gehen, und wir gingen geradewegs immer am Fluss entlang im Schutz der Bäume, um von niemandem entdeckt zu werden und ungewollte Begegnungen zu vermeiden und... als es Morgen geworden war, wir konnten es einfach nicht glauben, befanden wir uns genau an der Stelle, von der wir heute Nacht losmarschiert waren. Wer hätte das geglaubt, dass wir die ganze Nacht wie drei perfekte Blödmänner rund um einen See gelaufen sind, in dem Glauben, es wäre ein Fluss. Wir wurden unseres Irrtums erst gewahr, als wir vor uns die Hütte des Marokkaners sahen, in der wir übernachtet hatten. Was sollten wir nun machen? Wir entschlossen uns kurzerhand in die Fabrik zu gehen, und da es niemandem aufgefallen war, dass wir uns davongemacht hatten, gingen wir ganz routinemäßig an unsere Arbeit, als ob nichts vorgefallen wäre, aber mit der Gewissheit, dass jetzt keiner mehr unsere Fluchtpläne durchkreuzen konnte und dass wir noch am gleichen Tag das Fabrikgebäude verlassen und losmarschieren würden. Unser Entschluss war gefasst und es gab kein Zurück mehr, und wir durften uns nicht von der trostlosen Situation entmutigen lassen.
Bei der Familie Fertig
Cesario hatte folgende Bemerkung in sein Tagebuch eingetragen: „Es ist Sonntag, der 20. Januar 1945. Es schneit unaufhörlich. Um sieben Uhr brechen wir auf und verlassen das Fabrikgelände.“18 Tagebuch, S. 7-8. Frühmorgens verließen wir, ich und Cesario, das Fabrikgelände und passierten in aller Ruhe und unbemerkt den Haupteingang, Niccolino hingegen hob einen Zaunpfahl aus und hatte so auf seine Art das Fabrikgelände verlassen. Wir kannten bereits unser Reiseziel, Heidelberg, ein Städtchen südöstlich von Mannheim gelegen, wo, das wussten wir, Leute für alle möglichen Arbeiten gesucht wurden. Um unseren Plan zu verwirklichen, mussten wir uns zuallererst unserer Ausweispapiere entledigen, d. h. unauffindbar wegwerfen. Und zwar aus folgendem Grund: Hätte man uns mit den Ausweispapieren der Fabrik erwischt, wären wir schnurstracks dorthin zurückgebracht worden und hätten nie unser Ziel Heidelberg erreicht. Ich behielt nur die Fotografie mit der Nummer 929, hielt sie aber gut versteckt. Cesario notierte: „10 Uhr Ankunft in Mannheim. In einem Lokal ein bitterer Kaffee und das Frühstück gekauft.“19 Tagebuch, S. 8. Danach warteten wir auf den Zug nach Heidelberg. Und während wir warteten, wurden wir von einem Bombenangriff überrascht, der auch die Eisenbahnlinie zerstörte, und so waren wir gezwungen, in Mannheim in einer Privatunterkunft zu übernachten.
Am nächsten Tag, es schneite noch immer, machten wir uns zu Fuß auf den Weg nach Heidelberg, der über die Rheinbrücke führte. Zu unserem großen Glück wurden wir auf unserem Fußmarsch nach Heidelberg von niemandem belästigt oder befragt, von gar niemandem, auch nicht, als wir die Rheinbrücke überquerten. Auf der Brücke war es voll von Wachposten und immer wenn wir uns einem Posten näherten, grüßten wir, um von diesen Wachposten nicht angehalten zu werden, auf deutsch: „Heil Hitler.“ Es scheint geradezu unglaublich, aber wir gelangten nach Heidelberg, ohne aufgehalten zu werden, ohne dass jemand nach unseren Ausweisen gefragt hätte. Sobald wir ankamen, gingen wir zuerst in ein Gasthaus und ließen uns eine ordentliche Mahlzeit servieren, um unseren Hunger zu stillen, anschließend gingen wir zum Arbeitsamt. Während wir uns dort umschauten, hörte Cesario jemanden im Büro, der sich mit einer anderen Person auf französisch unterhielt, und da er gut französisch sprach, wandte er sich dieser Person zu, fing an zu reden und so kamen sie ins Gespräch. Man fragte uns, was wir denn gelernt hätten, welches Handwerk wir erlernt hätten, und wir gaben zur Antwort, dass wir Bauern wären. Wir hatten uns absichtlich als Bauern ausgegeben, da wir wussten, dass man Arbeitskräfte zur Aushilfe bei Bauernfamilien suchte, denn die Männer waren alle an die Front geschickt worden. Wie erwartet, wurden wir denn auch einigen Familien in Laudenberg, nahe Mosbach, zugeteilt, wo dringend Arbeitskräfte gebraucht wurden. Durch ein Missverständnis hätten wir beinahe unseren gewollten Arbeitsplatz verweigert, denn als man uns sagte, dass Schäfer, d. h. Bauern, gebraucht wurden, verstanden wir statt Schäfer das ähnlich klingende französische Wort Chauffeur, zu deutsch Fahrer, und wollten schon absagen. Dann aber stellte sich der Irrtum schnell heraus und wir nahmen das Angebot an und sagten zu. Ohne weitere Zeit zu verlieren, nahmen wir sogleich einen Zug und fuhren nach Mosbach. Dort angekommen, stiegen wir um in die Kleinbahn nach Laudenberg, und als wir dort eintrafen, blieben wir im Zug sitzen, weil wir dachten, wir wären noch nicht da. Als wir dann kapierten, dass wir doch schon da waren und hätten aussteigen müssen, hatte sich der Zug schon in Bewegung gesetzt und kam langsam in Fahrt. Was sollten wir also machen? Zeit zum überlegen hatten wir keine. Also sprangen wir kurzerhand aus dem fahrenden Zug! Gottseidank war er noch nicht richtig in Fahrt gekommen, auch lag hoher Schnee, der uns bis zur Hüfte reichte, und so ließen wir uns in den weichen Schnee fallen und blieben alle unversehrt.
Eine kleine Wegstrecke stapften wir durch den Schnee, dann sahen wir in der Ferne ein Licht und gingen darauf zu. Nach einer Weile kamen wir dort an, und vor uns stand ein Bauernhaus. Wir zeigten den Bewohnern unsere Papiere, die das Arbeitsamt ausgestellt hatte, und so wurden wir hereingelassen. Auch diesmal trafen wir Leute, die uns wohlgesonnen waren. Wir hatten angeboten und waren bereit, auch im Stall zu schlafen, aber der Hausherr, ein Mann vorgeschrittenen Alters, winkte ab und wollte uns unbedingt in seinem Haus beherbergen, aber zuallererst bat man uns zu Tisch und gab uns reichlich zu essen. Morgens weckte er uns frühzeitig, denn wir mussten zum Bahnhof und den Zug zurück nach Laudenberg nehmen. Bevor wir jedoch sein Haus verließen, hatte er uns ein schönes Frühstück zubereiten lassen. Danach stiegen wir in den Zug nach Laudenberg, und so waren wir endlich am Ziel unserer abenteuerlichen Reise. Am Bahnhof hatte sich eine Menschenmenge angesammelt. Wir fragten uns, was die da wohl machten, und da uns nach all den reichen Mahlzeiten zum Scherzen zumute war, bemerkten wir unter uns: „Die warten hier bestimmt auf uns!“ Der Scherz sollte sich bewahrheiten, denn wir wurden sofort gewahr, dass die Menge tatsächlich sehnlichst auf uns gewartet hatte, denn sie wussten von unserer Ankunft und benötigten dringend Arbeitskräfte, um die Felder zu bearbeiten, weil alle Männer, jüngere wie ältere, in den Krieg gezogen waren. Ein älterer Herr, der uns wohl zu betreuen hatte, nahm unsere Papiere an sich und teilte uns auf, Cesario hierhin, Niccolino dorthin und ich, ich vorerst zu niemandem. „Nanu? Sowas?“, sagte ich mir selber. „Und ich?“, fragte ich den Betreuer. „Du kommst mit mir“, sagte er und nahm mich mit in seine Wohnung, wo ich ein zweites Frühstück serviert bekam. Nach einer Weile kommt eine Frau, eine ältere Dame, ich weiß noch, sie trug ein Kopftuch, und nimmt mich mit zu ihrer Wohnung ganz in der Nähe. Ich war letztendlich bei der Familie Fertig.
Die Familie Fertig bestand aus acht Mitgliedern: Otto, der älteste und zugleich Familienoberhaupt, mit großem, langem Schnurrbart, Elisa, seine Frau, die Tochter Maria und dann war da auch noch die Schwester von Otto, die auch Maria hieß. Die Söhne, vier an der Zahl, waren alle eingezogen und an die Front geschickt worden. Sozusagen als Begrüßung wollten sie mir was zu essen geben, aber ich wehrte freundlich ab und erklärte, dass ich schon gegessen hätte, d. h. zweimal gefrühstückt hätte, und dass ich nur ein bisschen warmes Wasser bräuchte, um mich zu waschen. Und spätestens genau bei der Gelegenheit hatte man sofort erkannt, dass ich kein Bauer war. Ich hatte nämlich meinen Oberkörper frei gemacht, um mich zu waschen, und so kam meine blasse Hautfarbe zum Vorschein. Der Alte sah mich und sagte sofort erstaunt: „Du bist kein Schäfer“, womit er meinte, dass ich kein Bauer war. Es lagen da einige Postkarten oder Briefe, ich weiß nicht mehr genau, und indem ich dorthin zeigte, sagte ich ihm, dass ich Postbote wäre und danach erzählte ich ihm, dass ich mich auch als Händler betätigt hätte. Alsdann fragte ich ihn: „Arbeit?“, d. h. „an die Arbeit?“, und sie gaben mir zur Antwort: „Morgen früh um fünf Uhr.“ Ich musste also am nächsten Morgen um fünf Uhr mit meiner Arbeit beginnen, allerdings war ich schon um vier Uhr auf den Beinen.
Der 23. Januar 1945 war der Beginn unserer Tätigkeit als Gehilfen in der Landwirtschaft. Niccolino wurde einer Familie zugeteilt, die aus drei Frauen bestand, weil der Ehemann einer der Frauen zur Wehrmacht einberufen worden war. Er fühlte sich sehr wohl in der Familie und hatte auf diesem Hof mit den drei Frauen das Kommando übernommen. Alle drei waren froh, dass ein Mann als Befehlshaber im Hause war, unter dessen Führung sie gerne ihre Arbeit verrichteten. Für ihn hingegen war Essen und Trinken zum Hauptlebenszweck geworden. Nun geschah es eines Abends zu später Stunde, dass der Ehemann ganz unerwartet vom Kriegsdienst heimkam. Niccolino befand sich im Haus und dieser Deutsche, als er ihn erblickte, hob sofort seine Hände hoch und war sogar bereit, ihm sein Gewehr auszuhändigen, als Zeichen, dass er sich ergeben wollte, und dieses ganze Geschehen spielte sich noch dazu in seinem eigenen Haus ab. Das Komische an der ganzen Geschichte war, dass sich dieser vom Kriegsdienst Heimgekehrte dem Fremden, den er gar nicht kannte, ergeben wollte. Niccolino, dem nur das gute Essen wichtig und alles andere gleichgültig war, gab denn auch zur Antwort, dass er nicht wüsste, was er mit dem Gewehr anfangen sollte. Dieser heimgekehrte Deutsche, der als Wache in einem Gefangenenlager seinem Dienst nachging, wollte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und hatte sich kurz vor Kriegsende aus dem Staub gemacht, musste sich aber seitdem immer versteckt halten, zumindest so lange wie auch wir da waren und wahrscheinlich sogar bis zur Ankunft der Amerikaner. Mir ging es ebenfalls sehr gut. Cesario hingegen war eher unzufrieden und wollte weg von der Familie, wo er untergebracht war. Er fand immer einen Grund, um sich zu beklagen: „Ich bleib hier nicht, ich will hier nicht bleiben, hier gefällt’s mir nicht, weil die Leute sich immer über mich beschweren.“ Er wiederholte immer das Gleiche: „Hier will ich nicht mehr bleiben. Die Leute sagen, ich hinterlasse zu viel Dreck im Haus und würde mit den schmutzigen Stallschuhen durchs Haus laufen, und sie zeigen mir ihre mürrischen Gesichter." Er ging der gleichen Arbeit nach wie wir, machte auch die Stallarbeit, so wie ich und Niccolino. Und jeder weiß, dass die Schuhe im Stall verschmutzen. Immer wenn sie ihn zum Essen riefen, ging er mit seinen schmutzigen Schuhen, an denen noch der Kuhmist klebte, nach oben ins Haus. Was hätte es ihn schon gekostet, den groben Dreck zu entfernen oder die Schuhe auszuziehen, bevor er durchs Haus laufen und sich an den Esstisch setzen würde? Das war ihm nicht im Geringsten eingefallen, also hatten die Leute recht, wenn sie sich über ihn beklagten! Ich hatte mir Holzpantinen besorgt, hätte er nicht das Gleiche tun können? Fast alle, die überall auf den Bauernhöfen mit aushalfen, und das waren recht viele, schliefen in den Scheunen, so auch Niccolino und Cesario. Ich hingegen schlief in einem Zimmer, hatte sogar Bettlaken, und als ich das den anderen, die ich sonntags beim Bummeln traf, erzählte, wollte mir das keiner glauben. Was für eine geachtete Familie das doch war! Wenn ich den Dorfbewohnern erzählte, dass ich bei der Familie Fertig untergekommen war, war die Reaktion immer einmütig: "Ja, die Familie Fertig, die ist hier hoch angesehen." Ich war dort wirklich gut aufgehoben und wurde wie ein Fürst von einstmals behandelt, den man auf der Tragbahre spazieren führte.
Morgens stand ich um fünf auf, und als erstes ging ich in den Stall, kümmerte mich um die Tiere und mistete aus. Trockenes Stroh war kaum vorhanden, und ich musste darauf achten, dass kein einziger Strohhalm zuviel an die Tiere verfüttert wurde, denn das Stroh war sogar teurer als das knappe Brot. Um uns einen Ersatz für Stroh zu beschaffen, fuhren wir mit einem vierrädrigen Karren, der mit einer Wagenleiter bestückt war und von den Kühen gezogen wurde, los, um das Winterlaub einzusammeln, das wir zusammenharkten und auf den Karren luden. Statt mit Stroh wurde der Stall dann mit diesem Laub ausgelegt. Ich gab all meine Kraft, um die mir zugeteilte Arbeit bestmöglichst zu erledigen, und man wäre nie darauf gekommen, mir Arbeiten aufzubürden, die für mich zu schwer gewesen wären oder die ich nicht hätte bewältigen können. Das Melken erledigten die Frauen. Allerdings hatte man mich anfangs gefragt, ob ich melken wollte, aber nach einigen nicht geglückten Versuchen musste ich aufgeben, und man hat mich dann auch nicht mehr danach gefragt. Wir hatten dreizehn Kühe und jede hatte ihren Namen, sodass wir sie rufen konnten, und Otto hatte mir eingeschärft, die Kühe auf keinen Fall schlecht zu behandeln oder zu beschimpfen. Und er wollte auch nicht, dass ich den Kühen Befehle auf italienisch gab: „Denn nachher, wenn du nicht mehr hier bist, wem sollten sie dann gehorchen, wenn sie gelernt hatten, auf Befehle in italienisch zu reagieren?" Einmal passierte es, dass mich eine Kuh aus einer Gefahr rettete. Es war Feierabend, und wir waren noch auf den Feldern zu Gange, als ich mit einer Kuh, die ich hinter mir her zog, vom Feld auf die angrenzende Straße hinüber musste. Um auf die Straße zu gelangen, die unterhalb der Felder entlang führte, musste man eine steile Böschung hinunter. Während ich am Feldrand lang ging, um eine passende Stelle ausfindig zu machen, verlor ich das Gleichgewicht und begann die Böschung hinunterzuschlittern. Im selben Augenblick ging die Kuh ebenfalls zu Boden, landete auf ihrem Bauch, die vier Beine von sich gespreizt und rührte sich nicht. Ich hatte noch die Leine fest in der Hand, sonst wäre ich die Böschung hinunter auf die Straße gepurzelt. Sie hatte mich wohlweislich davor bewahrt. Seitdem war sie meine Lieblingskuh, die die anderen anführte. Sie hieß Fanny.
Auch Schweine waren auf dem Hof. Die Schwester von Otto, Maria, hatte dafür gesorgt, dass ich mit der Säuberung des Schweinestalls nicht beauftragt wurde, weil das Ausmisten eine dreckige Angelegenheit war, und diese Arbeit verrichtete sie selber einmal in der Woche. Die Schweine blieben immer im Stall, ohne Auslauf, weil man sie so am besten mästen konnte, bis sie richtig fett geworden waren. Stell dir mal vor, wie viel Dreck sich in solch einem Stall anhäufte, aber man wollte mir die Arbeit des Ausmistens nicht zumuten und diese Drecksarbeit sollte mir erspart bleiben. Kein einziges Mal durfte ich da mit hinein und vielleicht mithelfen. Ich hatte mich natürlich bemüht, die mir anvertrauten Arbeiten so gut wie eben möglich zu meistern, aber darüber hinaus fertigte ich für meine Gastgeber zum Beispiel kleine Schnitzereien aus Holz an. Aus einem Stück Nussbaumholz, bereits abgelagert, schnitzte ich den Griff für eine Heusense. Aber was man am meisten schätzte, waren meine geschnitzten Blumenkästen für die Fensterbänke außen am Haus.
Morgens standen wir um fünf Uhr auf, und wenn ich den Kuhstall bis um acht nicht fertig hatte, rief Otto mir zu, pünktlich wie eine Uhr: „Frühstück ist fertig, es ist acht Uhr! Zum Frühstück!“ Es kam schon mal vor, dass ich antwortete: „Aber ich bin noch nicht fertig“, worauf er erwiderte: „Die Tiere können warten!“ Was auch immer man gerade machte, man musste pünktlich zu den Mahlzeiten erscheinen. Um Punkt acht Uhr wurde gefrühstückt, und es wäre nie vorgekommen, dass ich zur Essenszeit noch irgend eine Arbeit hätte erledigen müssen, nein, die Essenszeiten wurden strikt eingehalten, d. h. Frühstück um acht, Mittagessen um zwölf, Kaffeetrinken um vier und auch das Abendessen immer zur gleichen Zeit. Dieser Rhythmus, an den man sich schnell gewöhnt hat, war ertüchtigend und urgesund. Zu essen gab es immer reichlich, reichlich und gut.
Zum Frühstück gab es immer Milchkaffee, Brot, Marmelade und Butter. Das Mittagessen bestand hauptsächlich aus verschiedenen Wurstarten und als Getränk wurde Apfelmost, auch Apfelwein genannt, serviert. Ein eher leichtes Getränk, schön klar, aber wenn ich davon trank, wurde mir sehr warm um die Ohren, und ich verstand nicht warum. Wer weiß, welchen Alkoholgrad der Apfelwein erreichen kann! Bei uns zuhause wird aus Äpfeln Essig gewonnen, aber kein Wein. Der Apfelmost wurde bis zur Abfüllung in Fässern zur Reife gebracht und aufbewahrt, die sahen so ähnlich aus, wie unsere in den Weinkellern stehenden Fässer. Machmal war mir allerdings danach zumute, auch mal etwas Bier zu trinken und die Gelegenheit dazu ergab sich, als ich mich mit Cesario und Niccolino in der Dorfkneipe traf, und dort probierte ich auch das erste Mal ein dunkles Bier.
Zum Abendessen gab es meistens Brot in Scheiben, das in einer mir ungewohnten Weise zubereitet und serviert wurde. Die Scheiben wurden zuerst längere Zeit in heißes Wasser gelegt und eingeweicht und danach mit Milch übergossen. Und dazu Pellkartoffeln, die in die Milch getunkt wurden. Ich hingegen streute Salz auf die Kartoffeln und ließ sie mir so besser munden. Kartoffeln gab es auch zum Mittagessen; sie waren als Grundnahrungsmittel aus der täglichen Kost einfach nicht mehr wegzudenken. Eine der vielen Zubereitungsarten bestand darin, dass man einen großen Eimer mit einer Riesenmenge Kartoffeln füllte, sodass die obere Schicht dampfgegart wurde: Das waren dann die, die gegessen wurden. Jeder konnte beliebig viele davon nehmen, sie wurden gepellt und die Schale warf man zurück in den Eimer, und alles zusammen, Schalen sowie übriggebliebene Kartoffeln, wurde an die Schweine verfüttert. Ich habe nie an Hunger leiden müssen, niemals. Wir hatten wirklich immer genug von allem: Butter, Margarine, Brot und viele andere Lebensmittel. Es fehlte an nichts. Das was ich aß, aß ich gern, das was übrig blieb, hob ich mir meistens für den nächsten Tag auf, und so langsam hatte sich ein kleiner Vorrat angesammelt. Die Butter, so wie viele andere Lebensmittel, war rationiert und wurde uns zugeteilt, aber die hausgemachte, die heimlich nachtsüber von Hand hergestellt wurde, war viel besser und mit der zugeteilten Butter gar nicht zu vergleichen. Sie hatten ein hölzernes Butterfass, das innen mit zwei sich gegenüberliegenden Flügelrädern bestückt war, die ihrerseits von einer handbetriebenen Kurbel, die an der Außenwand des Fasses angebracht war, bewegt wurden und so den Inhalt, d. h. die Sahne als Rohprodukt, verquirlten, bis die Sahne immer dickflüssiger wurde und zuletzt eine Butterkugel entstand, rein und natürlich. Aber bevor man anfing zu buttern, begab sich Otto Fertig immer vor das Haus und schaute, ob die Luft auch rein war, denn das Buttern war nicht erlaubt.
Mittlerweile näherte sich der Tag unserer erneuten Abreise, der Tag der endgültigen Befreiung im April 1945.
Am Palmsonntag gehen wir zur Messe, so wie es auch an anderen Sonntagen üblich war, und als wir auf unserem Rückweg sind, kommen uns Flüchtlinge entgegen, Russen, Italiener, Franzosen, die uns von der Befreiung Mannheims berichten, die bereits stattgefunden haben soll. Es ist Karfreitag, drei Uhr nachmittags, das Dorf ist mit weißen Fahnen geschmückt, um die Befreier zu begrüßen. Wir sind außer uns vor Freude, denn die Furcht vor der deutschen Polizei saß uns noch in den Knochen. Von mehreren Personen erfahren wir, dass die Amerikaner schon seit drei Tagen eine Straße befahren, die nur drei Kilometer von uns entfernt ist. 20 Tagebuch, S. 10-11.
An eine Begebenheit habe ich mich immer mit Freude erinnert und denke gern daran zurück, nicht nur weil ich an diesem Tag das erste Mal die Amerikaner sah, sondern vor allem wegen der feierlichen Osterstimmung bei mir zuhause. Es war Ostern und die Familie Fertig (ich war inzwischen Vollmitglied der Familie geworden) hatte für jeden gefärbte Ostereier gefertigt. Ich kann mich noch genau erinnern, wie die Ostereier gefärbt wurden. Sobald das Wasser kochte, wurden die Eier in gefärbtes Seidenpapier eingewickelt und in den mit kochendem Wasser gefüllten Kessel gelegt. Nachdem sie hart gekocht waren, nahm man sie heraus und jedes Ei hatte die jeweilige Farbe des Seidenpapieres angenommen. Jeder bekam als Geschenk zwölf Ostereier und jedem war eine besondere Farbe zugedacht, für mich hatte man die Farbe grün (grün ist die Hoffnung) ausgewählt.
Am Ostersonntag nach dem Mittagessen gingen wir, ich, Cesario und Niccolino, in ein nahegelegenes Dorf, wo, das hatte man uns erzählt, die Amerikaner vorbeikommen würden. Wir wollten mit unseren eigenen Augen sehen, ob das stimmte oder nur ein Gerücht war, und tatsächlich sahen wir die Amerikaner vorbeifahren. Dieser Tag, Ostersonntag, der 23. April 1945, hat sich unvergesslich in meinen Lebenslauf eingeschrieben und war einer der schönsten Tage meines Lebens. Nachdem wir ungefähr drei Kilometer gelaufen waren, kamen wir an eine Wegabzweigung und sahen dort, wir konnten unseren Augen kaum trauen, einen Panzer, den ersten amerikanischen Panzer, den wir zu Gesicht bekamen, bewegungslos am Rande der Straße stehen, oben drauf saß ein Soldat. Mir fiel das merkwürdige Verhalten des Soldaten gleich auf. Wir wollten alle drei gleich eine Zigarette von ihm. Als er sie uns gab und antwortete, hörten wir sofort heraus, dass er italienischer Abstammung sein musste, Italo-Amerikaner, Sizilianer oder Kalabrier. Nachdem wir ihm gesagt hatten, dass wir Italiener sind, stellten wir ihm Fragen über Fragen, zum Beispiel von woher sie herangerückt waren, was über die Kriegsfronten zu berichten war und andere Fragen. Während wir da standen und uns mit dem Soldaten unterhielten, kam ein zweiter Soldat aus dem Bauch des Panzers zum Vorschein und sagte dem da oben einige Worte auf englisch, worauf unser Gesprächspartner keinen Laut mehr von sich gab. Er sagte nichts mehr auf italienisch, nur auf amerikanisch. Wer weiß, was der Wortwechsel zwischen den beiden zu bedeuten hatte, vielleicht vermuteten sie auch, dass wir Spione sein könnten.
Als wir nachher wieder zuhause waren, ereignete sich ein unangenehmer Vorfall. Als wir von unserem Rundgang zurückgekommen waren, machten wir es uns gemütlich auf der Liegewiese vor meinem Haus, das Haus der Familie Fertig, und legten uns auf den schönen grünen Grasteppich, uns war wirklich wohl zumute. Als Otto mich da in Gedanken versunken liegen sah, fragte er mich: „Wie geht’s?“ „Zahnweh“, antwortete ich und sagte, dass mir alle Zähne weh täten, aber er wusste das wohl, dass ich so kariesanfällige Zähne hatte. „Und du liegst da im Gras?“, meinte er mit besorgter Miene. Mit dem beleidigenden Ausruf „Ist egal“, fiel ihm Niccolino, dieser Blödhammel, ins Wort und fuhr fort: „Morgen früh ist für uns sowieso Abreisetag.“ Und Otto stand da, fassungslos, als ob jemand auf ihn geschossen hätte. Und dieser Idiot von Niccolino, als wäre das Gesagte nicht peinlich genug gewesen, legte noch eins drauf und meinte: „Wir sind den Amerikanern begegnet, da sind wir gut aufgehoben, die haben alles, Zigaretten, Schokolade...“ Du heiliger Himmel! Ich wäre vor Scham fast in den Boden versunken. Otto war sprachlos, er wollte das Gehörte einfach nicht glauben. Das hätte er wohl nie erwartet, und auch die Frauen, die aus dem Haus gekommen waren und das Gespräch mitbekommen hatten, trauten ihren Ohren nicht und waren betrübt und entrüstet zugleich. Der alte Fertig, der sich inzwischen wieder gefangen hatte, schaute mich ernst und vorwurfsvoll an und sagte dann: „Nun seid ihr also für die Amerikaner. Die ja, die euch mit Zigaretten und Schokolade ködern. Ich hab weder Zigaretten noch Schokolade...“, und damit meinte er wohl: „Hab ich dich denn nicht immer gut behandelt, dich in die Familie aufgenommen, dir ein Zimmer gegeben und essen konntest du nach Herzenslust?“
Ich wäre am liebsten noch geblieben, und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich bestimmt noch bis zum Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen abgewartet. Es tat mir wirklich leid, den Otto und seine Familie einfach so, mir nichts, dir nichts, im Stich zu lassen, wo ich doch immer wie ein Familienmitglied behandelt worden war, und auch für die Familie Fertig war es traurig, mich abreisen zu sehen, aber was sollte ich machen? Die andern, aber hauptsächlich Cesario, drangen darauf, so bald wie möglich unsere Koffer zu packen. Wir waren bis jetzt immer zusammen geblieben und wir hatten uns geschworen, immer zueinander zu halten, um jeden Preis. Und so war ich letzten Endes auch neugierig und wollte mit eigenen Augen sehen, was die Amerikaner machten, wie weit sie vorgerückt waren, wie sich die Fronten tatsächlich verschoben hatten und wie die allgemeine Kriegslage wirklich war. Allerdings war ich noch im Zweifel darüber, welche Vorgehensweise denn nun in dieser noch ungewissen Lage am besten wäre, und so sagte ich zu Cesario: „Glaub nicht, dass wenn wir jetzt aufbrechen, die Amerikaner einen Lastwagen für uns bereitstellen und uns nach Hause fahren.“ Aber er war unnachgiebig und für ihn gab es kein Zurück mehr: „Morgen früh geht’s los, morgen früh machen wir uns auf die Beine, hier bleiben wir nicht“. Wer weiß, vielleicht wäre auch Niccolino noch eine Zeitlang geblieben, aber Cesario hatte nun einmal den Entschluss gefasst und wäre nicht bereit gewesen, seine einmal getroffene Entscheidung rückgängig zu machen. Am nächsten Morgen, Ostermontag, sah er uns an, dass wir beide unschlüssig waren und sagte: „Wenn ihr nicht mitkommt, ist mir das egal, ich gehe auch allein. Macht was ihr wollt.“ Uns blieb nunmehr keine andere Wahl und wir willigten ein.
Obwohl es den Fertigs sehr leid tat, dass ich nun doch entschieden hatte, aufzubrechen und heimwärts zu fahren, wurde ich wie immer und bis zuletzt wie ein Familienmitglied umsorgt. Für die Reise gab man mir reichlich Proviant, allerhand Wurst, Blutwurst, Brot, Getränke und sogar für das Osterfest gefärbte Eier. Ich war voll bepackt, genug um auch meine Kameraden mit durchzufüttern. Cesario und Niccolino hatten nichts dabei. Also machten wir uns auf den Weg. Bevor wir dann aber endgültig unseren Nachhauseweg antraten, verging noch über einen Monat und in dieser Zeit machten wir Bekanntschaft mit den Amerikanern.
Nach Kriegsende bekam ich von meiner Familie, den Fertigs, oft Briefe, die sie an meine Adresse in Florenz schickten, an den Laden von Freschi in Via Giosuè Carducci, denn ich hatte ihnen gesagt, dass ich aus Florenz komme. Als ich ihnen dann einen Brief aus Strada schrieb, wollten sie gleich wissen, ob ich denn von Florenz weggezogen wäre. Zu Weihnachten, gleich nach dem Krieg, machte ich ein Weihnachtspaket für sie fertig und legte einen Brief von mir bei, nur einen, keine drei. Von den anderen Sachen tat ich immer jeweils drei ins Paket, also drei Apfelsinen, drei Zitronen, drei Pfefferkuchen, drei Nougatstangen und sicher noch anderes Weihnachtsgebäck, aber von jedem immer drei an der Zahl, denn es waren drei Familien bei denen wir zu Gast waren. Als das Paket, das ich an mein zweites Zuhause, d. h. an die Familie Fertig adressiert hatte, angekommen war, wusste man sofort, ohne eine Erklärung meinerseits, dass der Inhalt für drei Familien gedacht war. Sie behielten also für sich zurück eine Apfelsine, eine Nougatstange, einen Pfefferkuchen und so weiter, und die verbleibenden restlichen zwei Drittel übergaben sie den anderen beiden Familien, d. h ein Drittel für jede. Dass der Inhalt mit den anderen geteilt wurde, war für sie eine Selbstverständlichkeit, es waren wirklich gewissenhafte und ehrliche Leute, die nicht allenthalben zu finden waren. Wo sind die Menschen, die sich so verhalten hätten wie diese Familie? Man müsste sie mit der Lupe suchen. Wir erhielten dann von allen Dankesbriefe, jeder von uns erhielt einen Brief von seiner Familie.
Nach zwanzig Jahren fuhr ich dann zurück auf Besuch, zusammen mit Guido und Francesco, um die Familie Fertig wiederzusehen. Leider waren die drei Alten in der Zwischenzeit verstorben. Der Sohn von Otto, Bruder von Maria, bewirtschaftet jetzt den Hof. Wir hatten uns nie kennengelernt, weil er damals, zu meiner Zeit, beim Militär war. Ich hatte noch ein Foto von seiner Schwester, ein Foto, auf dem sie achtzehn war. Ich hatte ihr auch meine Uniform da gelassen, sodass die Familie Fertig mich in Erinnerung behielt. Er gab mir ihre Adresse, denn sie hatte inzwischen geheiratet und war auf einem anderen Hof, der ziemlich weit entfernt war, und so fuhren wir dorthin und trafen sie auch an. Sie war gerade bei der Kartoffelernte, und als sie mich nach so langer Zeit so unverhofft kommen sah, war sie sichtlich gerührt und bekam einen hochroten Kopf, so wie damals, als ich mit ihrem Vater das erste Mal bei ihr zuhause ankam. Ich hatte sie dann alle nach Italien eingeladen, sie, ihren Mann und ihre Kinder, aber gekommen sind sie nie. Um ihnen eine Italienreise schmackhaft zu machen, erzählte ich, dass Städte wie Florenz und Rimini voll von deutschen Urlaubern wären. Daraufhin erzählte ihr Mann, dass er während des Krieges als Soldat in der Gegend von Rimini war und machte mit einer Handbewegung deutlich was er meinte: „Rimini?“, sagte er, und deutete mit der Hand auf Brust und Rücken und wollte damit ausdrücken, dass er von vorne und von hinten unter Beschuss geraten war. Tatsächlich war das der Fall gewesen, denn die Deutschen waren in Italien in einen Zweifrontenkrieg verwickelt worden, einmal gegen die vorrückenden Alliierten und zum anderen gegen die Partisanen, die ihnen in den Rücken fielen; von beiden Seiten wurde auf sie gefeuert. Unsere Freunde riefen dann noch einen anderen Bruder an, und bevor wir wieder fuhren, kam auch er, um uns zu begrüßen. Wir wollten uns dann wieder auf den Weg machen, wurden aber erst zum Essen eingeladen, so wie es bei der Familie Fertig schon immer üblich gewesen war, nach Art des traditionsbewussten Familienvaters Otto. Bevor wir wieder heimwärts fuhren, besuchten wir auch die anderen Familien, die uns ebenfalls freudig empfingen und sich sogleich nach Niccolino und Cesario erkundigten. Die beiden hatten sich allerdings nie aufgemacht, um ihre einstigen Gastgeber wiederzusehen.
Bei den Amerikanern
Wir sind immer noch unterwegs. Wie weit wird es wohl sein bis Mannheim? Vielleicht 70 km. 50 km haben wir schon hinter uns, also weiter im Schritt. Schöne Straßen. Und Niccolino: „ Ich kann kaum noch, hab ’ einfach keine Kraft mehr! “ Gilberto gebietet uns, Halt zu machen: „ Oh, guck mal, da steht ein Handwagen! “ „ Was sagst du da? Wo? “ Niccolino hat den Wagen inzwischen geholt und kommt jubelnd damit zurück. Dieses Gefährt wird uns noch sehr nützlich sein. Unsere drei Säcke aufgeladen, einer nach vorn und zwei nach hinten und ab geht ’ s! Es geht bergauf, aber leichter als mit dem Sack auf dem Rücken. Jetzt geht ’ s bergab, der Wagen rollt und ich versuche aufzuspringen, und... du glaubst doch wohl nicht, dass ich zu Fuß laufen will!!! Und so kommt der Wagen so richtig ins Rollen auf den glatten asphaltierten Straßen, die durch große und dichte Tannenwälder führen, und uns ist zum Lachen und Singen zumute und in unseren Gesang mischt sich das Getöse der vorbeirollenden amerikanischen Panzer und alle bestaunen unser Vehikel und winken uns zu. Und weiter geht es auf ebener Straße, dann abermals bergauf und wieder bergab, und wir kommen unserem gesteckten Ziel immer näher, unser Wägelchen bringt uns schnell voran. Wir kommen durch Dörfer, größere zerbombte Städte und durchqueren Kriegsschauplätze, auf denen noch vor kurzem wütend gekämpft wurde. Russen, Polen, Franzosen, alles Menschen aus europäischen Vaterländern, ziehen an uns vorbei, leidgeprüft und vom Schicksal gezeichnet, und doch zeigen ihre Antlitze jetzt einen Hoffnungsschimmer nach den Erfahrungen in der Zeit der Internierung oder der Gefangenschaft. Wir grüßen uns alle und helfen uns gegenseitig, und die weißen Sterne ziehen in rascher Folge an uns vorüber und geben uns einmal mehr die Gewissheit, dass dies die lang ersehnte Freiheit bedeutet. Es ist ein sonniger Frühlingsmorgen, und der Neckar mit seinen Schlössern zeigt sich unseren Augen in einer sanften Hügellandschaft. Wir folgen ein gutes Stück dem Flusslauf des Neckars, und danach geht es den Rhein entlang. Wir befinden uns jetzt westlich von Heidelberg, die Brücken sind allesamt zerstört, wir überqueren den Rhein in einer Fähre (der Handwagen ist inzwischen fester Bestandteil unserer Gruppe geworden). Heidelberg, Empfangsbereich der befreiten Italiener. Essen und Wein in Fülle. Noch am gleichen Abend werden wir zu einer anderen Empfangsstelle weitergeleitet. 21 Tagebuch, S. 22-27.
Diese Tagebuchnotiz hat Cesario geschrieben während wir unterwegs waren, um zu den Amerikanern zu gelangen. Deren Hauptquartier war in Mannheim, aber um dort hinzugelangen, mussten wir 70 km zu Fuß zurücklegen. Und Cesario: „Bei Gott, endlich haben wir die Freiheit erlangt.“22 Ibid., S. 12. Wir waren in diesem Durchgangslager zusammen mit vielen anderen, nicht nur Italiener, und wie wir, waren sie gekommen in der Hoffnung, versorgt zu werden und baldmöglichst heimkehren zu können. Wir wurden sogleich neu eingekleidet und erhielten eine neue schöne Uniform. Ich weiß noch, dass wir zusammen mit der Uniform auch eine Armbinde tragen mussten mit der Aufschrift CIV, d. h. Corpo Italiano Volontari (Italienisches Freiwilligenkorps), aber wir deuteten die Abkürzung um in Carne Italiana Venduta (Kanonenfutter). Wir hatten den ganzen Tag über nichts zu tun, und so blieb uns nichts anderes übrig, als uns mit Spaziergängen die Zeit zu vertreiben, fast den ganzen Tag hindurch.
Jeden Tag trafen vollbeladene Waggons mit allen möglichen Sachen ein, Güterwagen mit Sachen, die für die Soldaten bestimmt waren. In diesen Waggons war wirklich alles Mögliche zu finden, und um alles abzuladen, suchten die Amerikaner immer Freiwillige, die allerdings auch was dafür bekamen. Manchmal wurden wir jedoch getäuscht, indem man uns Arbeiten unterschieben wollte, die nicht eingeplant und vorher nicht abgesprochen waren. Zum Beispiel sollten wir einen Waggon ausladen, der schon einige Zeit im Freien gestanden hatte und mit Drehbank-Spänen beladen war. Um dieses Zeugs herunterzuladen, gab man uns Mistgabeln und Schaufeln, aber da dieser Waggon offen gestanden hatte, hatte sich außer einer dicken Staubschicht auch viel Rost gebildet. Nicht nur war dies eine Schmutzarbeit, sondern der aufgewirbelte Staub war für Augen und Atmung höchst unangenehm. Als morgens die Lastwagen eintrafen, um die freiwilligen Helfer abzuholen, mussten sie oft unverrichteter Dinge wieder abziehen und leer zurückfahren, denn niemand war gewillt, diese Drecksarbeit zu machen.
Wenn es sich aber darum handelte, die mit Lebensmitteln und Proviant beladenen Waggons zu entleeren, alles Waren, mit denen Amerika seine Soldaten versorgte, dann beeilten sich alle dabei zu sein und ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Diese Hilfspakete aus Übersee enthielten alles nur Vorstellbare, Kisten mit Eiern, Zigaretten, Schokolade, Konserven, Zahncreme, Zahnbürsten und hunderterlei anderer Dinge. Sogar Waggons mit Kartoffeln kamen aus Amerika, und es war mir unverständlich, warum man nicht die deutsche Kartoffel aß, das einzige Produkt, das reichlich vorhanden war. Wer weiß! Vielleicht waren sie misstrauisch. Wir waren also alle zur Stelle, wenn es galt, diese Waggons zu entladen, nicht zuletzt auch deswegen, weil wir hofften, ab und zu auch für uns etwas verschwinden zu lassen. Den Amerikanern war das aufgefallen, aber sie schwiegen und ließen fünf gerade sein. Ich muss jetzt wirklich lachen, wenn ich an einen Vorfall mit einem italo-amerikanischen Hauptmann zurückdenke. Da war einer unserer Landsleute, der sich wie viele andere auch die Hosen in Schenkelhöhe zugebunden hatte, um die Sachen, die er ergattern konnte, in seine Hosenbeine verschwinden zu lassen. Der Hauptmann musste alles mitverfolgt haben und versetzte diesem Langfinger eine saftige Ohrfeige, und weißt du warum? Nicht etwa, weil er beim Klauen erwischt worden war, nein, weil er nicht das Richtige, das Notwendige geklaut hatte. Dieser Mann, Italiener, hatte sich die Hosen mit Zahncreme oder Zahnbürsten vollgestopft, und wer weiß, vielleicht hatte er Zahncreme mit Schokolade verwechselt. Als der Hauptmann den Langfingrigen so breitbeinig gehen sah, vollgepfropft mit all dem Diebesgut, trat er vor ihn hin und befahl ihm: „Runter mit den Hosen und zeig mal, was du da alles weggesteckt hast.“ Sicher hatte er ihn die ganze Zeit genau beobachtet, und als er sich die Hosen auszog, gab er ihm eine schallende Ohrfeige, die man, das kann ich dir versichern, von hier bis zu uns nach Prato gehört hat. „Blödhammel“, nannte er ihn, „schau mal in die Runde wie viele deiner Landsleute hier sind, und keinem ist es eingefallen, sich an diesen Sachen zu vergreifen. Wenn du schon was mitgehen lassen willst, dann vielleicht Zigaretten oder notwendigerweise was Essbares, dann hätten wir ein Auge zugedrückt, aber doch keine Zahnpasta, Blödkopf du. Lass alles hier liegen, mach das du fortkommst und lass dir das ’ne Lehre sein fürs nächste Mal.“
Auch ich war einmal dort, um irgend ein lohnendes Objekt zu ergattern und mitzunehmen, aber es ist mir nie gelungen, etwas in meinen Hosentaschen verschwinden zu lassen, ich hab das einfach nicht fertig gebracht. Der Cesario war da dreister und hatte einen Plan, in den er mich einbinden wollte, wo er Stehler war, und ich wenigstens die Rolle des Hehlers übernehmen sollte. Er sagte: „Hör mal zu, wie wir das machen. Wir gehen morgen wieder und helfen abladen, und du wartest hier auf uns.“ Und sie kamen tatsächlich mit den gestohlenen Sachen, und ich stand Schmiere und bewachte das Geklaute. Ähnlich wie wir, ging auch die deutsche Bevölkerung zu Werke, denn es mangelte an allem. Sie kamen zu diesen Abladestellen und versuchten irgend etwas zu ergattern und mitzunehmen. Ohne Unterlass kam immer neue Ware, die nicht etwa in Schuppen untergebracht, sondern zeitweilig entlang der Autobahn deponiert wurde. Das war die Autobahn, die von Paris nach Berlin führte und aus riesigen Zementblöcken bestand. Also, auch die Deutschen versuchten, hier und da was zu ergattern, und die Amerikaner ließen sie gewähren. Eines Abends jedoch passierte es, dass ein Waggon in Flammen aufging; sicher hatte ein Deutscher, dem die Besatzer ein Dorn im Auge waren, Feuer gelegt und seitdem wagte sich keiner mehr in die Nähe der Waggons, denn die Amerikaner hielten jetzt Wache, Gewehr bei Fuß.
Während unserer Zeit mit den Amerikanern ereignete sich ein Vorfall, der mir im Gedächtnis geblieben ist und der einen ungewöhnlichen Ausgang genommen hatte. Ein Russe war in einem deutschen Gefangenenlager von einem deutschen Wachposten misshandelt worden und hatte sich Gemeinheiten von diesem gefallen lassen müssen. Er erfuhr dann, dass dieser berüchtigte Kerkermeister mit allen möglichen bösartigen Handlungen auch andere Gefangene malträtiert hatte. Dieser Russe konnte das an ihm geschehene Unrecht einfach nicht hinnehmen und wollte sich rächen und bat alle um Mithilfe, um diesen Kerkermeister aufzuspüren. Er wollte erst dann wieder in sein Heimatland zurückkehren, nachdem er mit diesem Menschen abgerechnet hätte, d. h. er wollte ihn umbringen, so zornig war er auf ihn. Und so fand er schließlich nach langem Suchen seine Adresse, und da der Wohnort nicht weit entfernt war, ging er hin, um ihn zu stellen und um sich mit ihm zu konfrontieren. Er traf dort den Bruder. Als er ihm sagte, dass er auf der Suche nach seinem Bruder wäre und weshalb, antwortete ihm dieser: „Du bist zu spät gekommen. Meinen Bruder aus der Welt zu schaffen, das hab’ ich bereits übernommen.“ Diese Brüder waren alles andere als Brüder und müssen so gegensätzlich wie nur irgend möglich gewesen sein, um solch eine Tat zu begehen. Nach dieser Begegnung mit dem Bruder und nachdem er sich vergewissern konnte, dass der Gesuchte nicht mehr lebte, begab er sich auf den Heimweg. Dieser Kerkermeister muss wirklich ein Krimineller gewesen sein.
Eine andere Geschichte, die sich meinem Gedächtnis eingeprägt hatte, war, als wir einem älteren Deutschen begegneten, der bei uns in der Anilik-Fabrik gearbeitet hatte. Als wir dort zusammen arbeiteten, nahm er sich immer einen kleinen Essensvorrat mit, und wir schauten ihm zu, wenn er sein Frühstück verzehrte, das aus zwei Schnitten Brot und zwei Essiggurken bestand. Er sah uns an, dass wir mit unseren Augen sein Frühstück mitaßen und so gab er mir und den anderen immer etwas ab, wenig, aber etwas hatte er immer für uns übrig. Eines Tages war er verschwunden, und wir hatten ihn aus den Augen verloren. Dann, ganz unverhofft, sahen wir ihn wieder, als er ebenfalls bei den Amerikanern auftauchte, um sich etwas Essbares zu besorgen. Ich stand da mit Niccolino, aber wir hatten ihn nicht sofort erkannt. Er hingegen hatte uns sofort gesichtet und kam uns entgegen. Und Niccolino, der mich schon öfter in Verlegenheit gebracht hatte, konnte mal wieder nicht an sich halten und platzte gleich heraus mit der taktlosen Bemerkung: „Wir haben dein Frühstück nicht mehr nötig. Bei den Amerikanern gibt’s alles, Schokolade, Zigaretten, alles was der Magen begehrt.“ Am nächsten Morgen hatte sich der arme Alte wieder eingefunden. Er kommt auf uns zu und sagt: „Sieh da, ihr habt ’ne Menge Sachen, wie komm ich nun zurecht? Könnt ihr mir helfen?“ oder auch anders herum: „Jetzt hab’ ich Hunger. Als du in Not warst, habe ich dir geholfen und hab dir zu essen gegeben, jetzt bist du dran, mir zu helfen.“ Ich hatte mir ein bisschen Schokolade besorgt und gab sie ihm, und dann besorgte ich ihm auch einige Zigaretten. Unser Freund kam dann noch zwei oder drei Mal, und eines Morgens gab ich ihm auch ein Brot. Dem Niccolino passte das mal wieder nicht, und er meinte missbilligend: „Also, jetzt kriegt der auch noch das Brot, das uns dann fehlt.“ „Hast du es nicht gern entgegengenommen und gegessen, wenn er dir was abgab, Dummkopf“, gab ich ihm zu verstehen. Überdies hatte der Alte auch eine Familie zu versorgen.
In der Zeit, die wir bei den Amerikanern verbrachten, wurden wir mehrmals versetzt, bis wir zuletzt in dem Ort Frankenthal landeten und dort:
Wir arbeiten in einem Lagerhaus für Lebensmittel und Getränke, also zu essen und zu trinken haben wir mehr als genug. In Frankenthal werden wir in eine Uniform gekleidet und wie Amerikaner behandelt und leben wie im Schlaraffenland, essen, trinken, schlafen und... süßes Nichtstun.23 Tagebuch, S. 27-28.
25. April 1945
Als in Italien der Tag der Befreiung gefeiert wurde, waren wir noch in Deutschland und konnten deshalb nicht dabei sein. Aber seitdem ist kein Jahr vergangen, an dem wir nicht gebührendermaßen mitgefeiert haben. Vor einigen Tagen war der 25. April24 Am 25. April wird in Italien das Fest der Befreiung von der faschistischen Diktatur gefeiert. und als ich einem Bekannten hier aus Strada begegnete, das war der Sohn eines Faschisten von damals, sprach ich ihn an und sagte: „Was für ein denkwürdiger Tag, heute, für mich der schönste Festtag überhaupt. Das Ende des Krieges, das Ende der Diktatur.“ Daraufhin schaute er mich mit einer finsteren Miene an und brummte missbilligend was vor sich hin. Am liebsten wäre es ihm gewesen, ich hätte ihm das gar nicht gesagt, aber ich wollte ihn damit absichtlich anstacheln und ärgern.
Ich weiß noch, dass sich bei Kriegsende die Partisanen an den Faschisten rächen wollten und einigen, die sich besonders hervorgetan hatten, die Köpfe kahl schoren. Die Partisanen kannten ihre Gegner genau und wussten, wer sich als Faschist besonders hervorgetan hatte, und es wurden Leute kahlgeschoren, die wir nicht im Geringsten verdächtigt hätten, Faschisten zu sein. Da lief zum Beispiel noch ein Kahlgeschorener herum, aber niemand hätte ihn jemals verdächtigt, ein Faschist zu sein. Als ich heimkehrte, begegneten mir zwei Glatzköpfe in Strada, ein Mann und eine Frau, bei denen ich niemals den Verdacht geschöpft hätte, dass sie dem Faschismus angehörten, aber da man sie kahl geschoren hatte, bestand kein Zweifel mehr daran. Diejenigen, die kahlgeschoren wurden, das waren in der Rangfolge eher die mittellosen Untergeordneten, die sich nicht nach Norditalien oder anders wohin absetzen konnten, weil ihnen die finanziellen Möglichkeiten dazu fehlten, sie kamen halt aus den ärmeren Mittelschichten. Die Rädelsführer hingegen, die Ranghöheren, hatten meistens mehr Bewegungsfreiheit und konnten sich rechtzeitig, als der Wind umschlug und sie Gegenwind zu spüren bekamen, absetzen. All diese Leute aus den Rängen der Faschisten flüchteten in den Norden Italiens, um sich in der Italienischen Sozialrepublik niederzulassen, auch die aus Strada ergriffen die Flucht, mitsamt ihren Familien, und die ganz fanatischen und eifrigen Anführer waren die allerersten, die sich aus dem Staub machten und Richtung Norden flohen. Als sie dann zurückkehrten, nach Ende des Krieges und nach dem Zusammenbruch des Faschismus, waren sie alle nackt und bloß, bar aller Ämter und Würden und, so schien es, auch von Reue geplagt. Einige dieser Heimkehrer hätte man gerne zur Rechenschaft gezogen und sich für erlittenes Unrecht gerächt, aber dein Großvater Beppe sagte immer: „Der Siege göttlichster ist das Vergeben“ und keinem bei uns zuhause wäre es jemals eingefallen, sich mit jemandem anzulegen, denn dem Großvater wäre das nicht recht gewesen.
8. Mai 1945: ich schreibe nach Hause
Während wir noch in Frankenthal waren, schrieb ich einen Brief, der lange unterwegs war und erst 20 Tage nach meiner Rückkehr zuhause ankam:
I hr Lieben,nach vielen Monaten des Bangens und der Angst fühle ich mich nun endlich frei und kann mir vorstellen wie froh Ihr seid, wenn Ihr meinen Brief empfangt. Neun Monate sind vergangen, währenddessen wir unter der Einwirkung eines erbarmungslosen und barbarischen Bombenterrors zu leiden hatten. Gottseidank ist nun alles vorbei und ich habe mich aus der Unterjochung befreien können. Stellt Euch meine Freude vor, oder vielmehr unsere Freude, denn Cesario und Niccolino sind auch bei mir, als wir am Ostersonntag dem ersten amerikanischen Panzer begegneten, wahrlich ein unvergesslicher Tag. Wie ich Euch bereits sagte, bin ich mit Cesario und Niccolino zusammen vereint in unserem Dreibund, allerdings waren auch Walter und Guido Moretti anfangs in unserer Gruppe, aber nach 5 Monaten verließ uns Walter und wir haben nichts mehr von ihm gehört. Guido hingegen, da sind wir uns ziemlich sicher, ist mittlerweile auch wohl auf freiem Fuß so wie wir und wird hoffentlich ebenfalls seine Familie benachrichtigt haben.Wir tragen jetzt eine amerikanische Uniform und werden in jeder Hinsicht wie Amerikaner behandelt. Während ich meine wiedergewonnene Freiheit voll auskoste, bin ich andererseits besorgt darüber, wie es Euch in dieser Zeit ergangen ist und wie viele traurige Stunden Euch beschert worden sind? Diese Ungewissheit, mit der ich tagaus, tagein leben musste, belastet mich nun nicht mehr, denn ich kann jetzt auf eine Antwort von Euch sicher sein. Der Tag, an dem ich Euch in allen Einzelheiten meine Erlebnisse schildern kann, wie in einem Roman, liegt nun nicht mehr in weiter Ferne, Hauptsache es ist alles vorüber und vorbei. Heute nur diese wenigen Zeilen, denn ich habe es eilig, diesen Brief an Euch abzuschicken, und in dem ich Euch herzlich grüße und gute Gesundheit wünsche. Ich selber bin gottseidank kerngesund geblieben. Küsse an Vati, Mutti und Euch alle. Euer Gilberto
8928 Italian Service Unit, A.P.O. 667 U.S. Army
Die Rückkehr nach Hause
Am 12. Juni 1945 traten wir unsere Heimreise an. Noch am gleichen Tag treffen wir mit der Eisenbahn in Florenz ein und kaum hatte der Zug gehalten, sagte ich: „Ich will mich hier nicht aufhalten. Wer mit mir kommen will, ich gehe jetzt in die Via Giosuè Carducci und da finde ich sicher jemanden, der uns mit nach Hause nimmt.“ Und Niccolino: „Nee, nee, ich geh vorher noch woanders hin. Wenn wir beim Sangallo-Hospital vorbeikommen, muss ich da wegen meiner Pension vorsprechen.“ Ich wollte da nicht mit hin, und deshalb war er ärgerlich mit mir. Aber für mich war es vorrangig, erst einmal den Freschi25 Gilberto und seine Familie nahmen oft die Speditionsfirma Freschi in Anspruch, um ihre lokalen Produkte, insbesondere Äpfel, Kirschen, Kastanien und Pilze, je nach Saison, nach Florenz zu schaffen und über den Freschi-Warenhandel zu verkaufen. in seinem Lagerhaus in Via Giosuè Carducci aufzusuchen und mit etwas Glück würde ich dort jemanden antreffen, der mich noch am gleichen Tag mit nach Hause nehmen würde. Außerdem hatte die Kirschernte gerade begonnen, und so hoffte ich einmal mehr, beim Freschi Bekannte aus Strada zu treffen, verstehst du. Aber leider war niemand zu finden, nur der Lastwagen stand da in einer Ecke. Ich und Cesario wir stiegen auf den Laster, machten es uns bequem, so gut es eben ging, deckten uns mit meinen Decken zu, die ich noch von Deutschland her immer bei mir trug und verbrachten so die Nacht auf der Ladefläche des Lastwagens. Wir fanden es richtig gemütlich und konnten sogar durchschlafen bis zum nächsten Morgen. Frühmorgens kam dann der Chiarini: „Sieh mal einer an, was für ’ne Überraschung“, meinte Beppe als er mich erblickte. „Was machst du denn hier?“ „Wir sind gestern aus Deutschland zurückgekommen“, antwortete ich und erzählte ihm in groben Zügen, wie es mir ergangen war. „Wer hätte das gedacht, dass wir uns hier treffen, und wenn man bedenkt, dass gestern noch dein Vater hier war, hier in Florenz“, gab er mir vielsagend zu verstehen.
Nachher gingen wir zum Ghibertiplatz und dort traf ich Gigi aus Pelo mit dem Lastwagen von Tito, der in Salutio zuhause ist. Die hatte ich dort angetroffen, weil die Kirschernte begonnen hatte und mit ihrem Transporter hatten sie die ersten Kirschen zum Verkauf nach Florenz gebracht, und da wir, ich, mein Vater und Gigi, bevor die Deutschen mich mitnahmen, beim Pilzesuchen und Kirschenpflücken immer zusammen gearbeitet hatten, fragte ich ihn: „Und mein Väterchen, was ist mit dem?“ „Du warst ja weg und deshalb meinte dein Väterchen, hätte er nicht gewusst, wie’s weiter gehen soll“, hielt er mir entgegen und wollte damit den Eindruck erwecken, als hätte mein Väterchen die Zusammenarbeit mit ihm aufgekündigt. Später erfuhr ich dann, dass er meinen Vater weder aufgesucht noch mit ihm gesprochen hatte. Und so konnte ich mit meinen Gefühlen nicht länger zurückhalten und sagte ihm frei heraus: „Auf dich ist wirklich Verlass, das muss ich dir sagen. Solange ich hier war, warst du froh einen Esel wie mich zu haben, kaum war ich fort, ist auch mein Vater für dich uninteressant geworden“, und hiermit gab ich ihm zu verstehen, dass ich doch recht ärgerlich über sein Verhalten uns gegenüber war. Nach dieser klärenden Auseinandersetzung haben wir dann aber doch wieder zusammengearbeitet. Mein Väterchen erzählte mir dann noch Folgendes: „Ich hatte auch versucht, die Kirschen zu kaufen, aber wie sollte ich das anstellen? Ich war ja ganz auf mich selbst gestellt.“ Das Kaufen war wohl weniger ein Problem, nur wusste er nicht, wie er sie nach Florenz schaffen sollte, am besten natürlich hätte er alles selber organisiert, aber mit seinem Postauto wäre das auch nicht gegangen.
Nach dem Essen machten wir uns dann auf den Weg nach Hause und stiegen in den Lastwagen von Tito, ich, Niccolino und Cesario. In Strada angekommen, stiegen wir aus und gingen gemeinsam in die Giovannina-Bar. Kaum war ich in der Bar, überkam mich eine große Müdigkeit und ich ließ mich kraftlos, wie ein Sack, in einen Sessel fallen, ich war mit meinen Kräften ganz plötzlich am Ende. Und wenn man bedenkt, dass mich bis jetzt nichts erschüttern konnte, weder die Bombenangriffe noch die Deutschen und deren Gewehre, auch nicht die durchgestandenen Leiden und Entbehrungen, aber als ich mich jetzt endlich sicher fühlen konnte, obwohl es mir nach langer Wanderschaft noch unglaubwürdig erschien, endlich zu Hause zu sein, dies alles war so überwältigend, dass ich meinen Gefühlen nicht mehr standhalten konnte. Wir drei waren mit die ersten, die heimgekehrt waren, und wir wurden natürlich nach dem Verbleib der anderen, die wie wir, ebenfalls in Deutschland waren, ausgefragt, aber bedauerlicherweise konnten wir über deren Schicksal nichts aussagen. Als die Leute aus Strada uns zurückkommen sahen, dachten sie seltsamerweise, wir hätten uns in der Zwischenzeit bereichert. Tatsächlich hatten wir uns bereichern können, nur wussten die Leute nicht, dass unser Reichtum darin bestand, dass wir heilfroh waren, nochmal mit heiler Haut davongekommen zu sein. So, jetzt rate mal, was dem Cesario durch den Kopf gegangen ist, was er denn unternehmen wollte, wenige Tage nachdem wir nach Strada zurückgekehrt waren? Er wollte sich als Freiwilliger melden, um gegen die Japaner in den Krieg zu ziehen. Das war für uns unfassbar, wo er doch immer darauf gedrängt hatte, sobald wie nur irgend möglich nach Hause zurückzukehren. Diese seine Entscheidung hatte uns so perplex gemacht, dass wir ihm antworteten: „Du wirst doch wohl nicht verrückt geworden sein, war denn dieser Krieg nicht schon mehr als genug für uns!“ Wer weiß, vielleicht war er von der Angst geplagt, jetzt arbeitslos zu werden und ohne Beschäftigung dazustehen. Vor dem Krieg war er bei der Sparkasse hier in Strada als Hausmeister angestellt, aber nach seiner Rückkehr wollte die Sparkasse ihn bedauerlicherweise nicht wieder einstellen, unter keinen Umständen.
Während ich mich nun auf dem Weg nach Hause befand, hatte mein Väterchen gerade seinen Rundgang beendet, um die Post auszutragen. Man sah ihn schon kommen, nicht unweit der Häuser von Barbiano, als ihm mehrere Personen begegneten und ihm zuriefen: „Giuseppe, beeil dich, fahr nach Hause, zuhause wartet ’ne Überraschung auf dich.“ „Was für ’ne Überraschung?“, fragte er neugierig. „Dein Sohn ist heimgekehrt!“ Und weißt du, was er sodann machte? Er war bereits an den Häusern von Barbiano vorbei und befand sich nun auf dem Nachhauseweg, aber da er wusste, dass da oben die Leute waren, die ihre Kirschen verkaufen wollten, kehrte er um, handelte Preis und Menge aus und kam dann nach Hause. Noch am gleichen Abend fuhr ich mit dem Kleinlaster von Freschi nach Florenz zurück, vollbeladen mit Kirschen, und übernachtete darin ein zweites Mal. Am nächsten Morgen traf ich dann auf dem Ghiberti-Marktplatz in Florenz noch einmal den Gigi aus Pelo, und blitzschnell fuhr mir nur ein Gedanke durch den Kopf und fast triumphierend sagte ich ihm: „Schau mal her, auch ohne dich hat mein Vater sie trotzdem kaufen können, die Kirschen!“
- 1. Gilberto Giannotti wurde am 17. Februar des Jahres 1916 in Strada in Casentino geboren und verstarb in seinem Heimatort am 8. August 1999.
- 2. G. Giannotti, Mi ricordo che... Erinnerungen, Geschichten, Briefe von Gilberto Giannotti, herausgegeben von G. Ronconi, Castel San Niccolò (AR), Eigenverlag Fruska – Gianni Ronconi, 2001 (Druck in limitierter Auflage, die bereits vergriffen ist).
- 3. Als ich mich das erste Mal zum Militärdienst meldete, hatte Gilberto sich für zehn Monate zur Infanterie nach Perugia verpflichtet, von Anfang März bis Ende Dezember 1938, und zwar als Schreibkraft. Im Mai 1940 wurde er als Telefonist und Wachposten in Arezzo eingesetzt, zuerst in der Kaserne Piave und anschließend beim Bezirkskommando, wo er bis März 1942 Dienst tat. Dann wurde er das zweite Mal beurlaubt. Im Juni 1943 kam er nochmal zum Einsatz, aber nach dem 8. September kehrte er zurück nach Hause.
- 4. Francioni war der Inhaber des Transportunternehmens, das die Fahrgäste von Strada in Casentino nach Porrena beförderte, von wo aus Gilberto dann den Zug nahm, der ihn nach Arezzo brachte.
- 5. Annina war die Tante von Gilberto und wohnte bei ihm in seinem Hause. Giannetto, Aurora und Federica waren die Geschwister von Gilberto. Der Onkel Gigi wohnte ebenfalls bei ihnen. Gilberto hatte außerdem noch eine Schwester, Leda, und natürlich seine Mama, Lisa.
- 6. Der Freschi war Lastwagenfahrer, der tagtäglich Waren vom Casentino nach Florenz und zurück transportierte.
- 7. Beide hießen Ferretti, waren aber nicht miteinander verwandt.
- 8. Der Piazzone ist ein Platz und die Giovannina eine Bar in Strada in Casentino.
- 9. Die Sita war die offizielle Buslinie und beförderte Fahrgäste von und nach Florenz.
- 10. Die Miliz war eine von den Faschisten gegründete geheime Staatspolizei, die in allen Gemeinden mit einem Sitz vertreten war. Wer dieser Miliz angehörte, hatte die Aufgabe, die Einwohnerschaft, insbesondere die Antifaschisten, zu kontrollieren.
- 11. In Vallucciole, Teil der nahegelegenen Gemeinde Stia, wurde am 13. April 1944 von deutschen Wehrmachts- und italienischen Faschisteneinheiten ein Blutbad angerichtet, bei dem 108 Zivilisten erbarmungslos getötet wurden, darunter auch Frauen, ältere Leute und Kinder, auch wenige Monate alte.
- 12. Die Salesianer, eine religiöse Gemeinschaft die von San Giovanni Bozzo gegründet wurde, bewohnten in Strada ein großes Gebäude, daß von allen Dorfbewohnern als Internat bezeichnet wurde, denn zusammen mit den Priestern wohnten dort sehr viele Jungen im Internat. Dieses Internat wurde ebenfalls von fast allen Dorfbewohnern besucht, die sich dort auf den Gebieten Religion, Schule und schöpferische Erholung betätigen konnten.
- 13. Häuserkonglomerat, das sich beiderseits der Durchgangsstraße gruppierte, ganz nahe dem Fluss Solano.
- 14. Cesario Ceruti war ein Freund von Gilberto und wurde mit allen anderen nach Deutschland deportiert. In einem kleinen Tagebuch hatte er alle Geschehnisse aufgezeichnet, die sich seit seiner Gefangenschaft bis zur Asylgewährung in einem amerikanischen Feldlager abgespielt hatten. Die beschriebenen Begebenheiten, die die ersten 28 Seiten seines Buches ausfüllen, stimmen inhaltlich mit den Erinnerungen, wie sie Gilberto niedergeschrieben hat, überein. Das Tagebuch befindet sich jetzt im Besitz von Gianni Ronconi. Wann immer in dieser Schrift auf das Tagebuch hingewiesen wird, wird es in Schrägschrift als Tagebuch bezeichnet, mit Seitenangabe.
- 15. Tagebuch, S. 7.
- 16. Tagebuch, S. 8.
- 17. Tagebuch, S. 13-21.
- 18. Tagebuch, S. 7-8.
- 19. Tagebuch, S. 8.
- 20. Tagebuch, S. 10-11.
- 21. Tagebuch, S. 22-27.
- 22. Ibid., S. 12.
- 23. Tagebuch, S. 27-28.
- 24. Am 25. April wird in Italien das Fest der Befreiung von der faschistischen Diktatur gefeiert.
- 25. Gilberto und seine Familie nahmen oft die Speditionsfirma Freschi in Anspruch, um ihre lokalen Produkte, insbesondere Äpfel, Kirschen, Kastanien und Pilze, je nach Saison, nach Florenz zu schaffen und über den Freschi-Warenhandel zu verkaufen.
- Toskana (Italien)
- Florenz (Toskana)
- Pratovecchio (Arezzo)
- Cetica (Strada in Casentino)
- Venedig (Venetien)
- Forlì-Cesena (Emilia-Romagna)
- Deutschland
- Laudenberg (Baden-Württemberg)
- Frankenthal (Rheinland-Pfalz)
- Zwangslager Oppau (Ludwigshafen)
- Zwangsarbeit
- Kriegsende (Italien)
- Gotenstellung
- Italienische Sozialrepublik
- Organisation Todt
- Kriegserklärung (Italien)
- Faschismus
- Massaker durch die Nazis und die Faschisten
- Benito Mussolini
- Deutsche Soldaten
- Numéro: OU001
- Lieu: Privatarchiv Gianni Ronconi